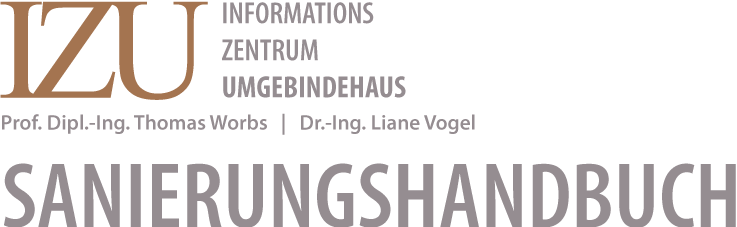Denkmalpflege
Denkmalschutz – Allgemein (Lit. 4f , 4l, 7a, 15)
Für die Besitzerin oder den Besitzer eines Umgebindehauses drängt sich die Denkmalfrage einfach schon dadurch auf, dass beim Bauantrag zur Sanierung seines Hauses die Untere Denkmalpflegebehörde zur Beurteilung einbezogen wird. Die rechtliche Grundlage bildet das Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen, kurz Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG). Viele Details sind aber auch in sog. Gestaltungs-satzungen geregelt. Mittels örtlicher Bauvorschriften kann die Stadt oder Gemeinde damit die Gestaltung von Gebäuden (z.B. Dachform, Materialien) und Grundstücken (z.B. Einfriedigungen, Begrünung) regeln. Diese Vorschriften können, verbunden mit einem Bebauungsplan oder als gesonderte Satzung, vom Rat der Gemeinde beschlossen werden. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung der Satzung wird diese dann rechtsverbindlich.
Die untere Denkmalbehörde wird – bei größeren oder wichtigen Objekten in Abstimmung mit der Oberen Denkmalpflegebehörde – die Einstufung als Denkmal bekannt geben und entsprechende Auflagen erteilen. Umgebindehäuser sind im Allgemeinen als Denkmal eingestuft und – seltene – unbekannte Bauobjekte werden nach behördlicher Prüfung als solche entdeckt. Es kann vorkommen, dass das Erkennen des Umgebindes nicht einfach ist, weil es eingemauert wurde, anderseits aber innen eine vollständige Blockstube erhalten blieb. Zum guten Umgang mit der Denkmalfrage gehört es, dass die Mitarbeiter der Denkmalbehörde ihre Vorschläge sorgfältig vor Ort in Beisein des Architekten der Sanierung besprechen. So kann im Gespräch ausgelotet werden, welche Auflagen bindenden Charakter haben und welche für Alternativvorschläge noch offen sind. Die Erfahrung zeigt, dass eine gemeinsame Analyse in entspannter Atmosphäre weiter führt, als eine fest gefügte Haltung, bei der der Bauherr oder Architekt sich früh eindeutig positionieren. Auch wenn der denkmalpflegebeflissene Verfasser gute Erfahrungen auf diesem Weg des Umgangs mit der Denkmalpflegebehörde hat, kann er nicht umhin, zu beobachten, dass viele Bauherren Schwierigkeiten haben, mit der Denkmalfrage sinnvoll umzugehen. Schnell urteilt man, dass Bauen am Denkmal teuer ist. Ein Glücksumstand ist, so lehrt die Erfahrung seit langem, dass viele Eigentümer den Denkmalcharakter ihres Hauses anerkennen und eine gute Pflege ausdrücklich wünschen. Erfreulich viele Handwerker zählen zu den Besitzern und sind durch ihre Erfahrungen mit dem Haus wahre Sanierungsspezialisten geworden und in der Lage und willens wertvolle Hinweise auch anderen Interessenten zu geben. Hochgradig problematisch dagegen sind häufig unsanierte, leer stehende Umgebindehäuser, welche durch Erbe oder Ankauf an Außenstehende gehen; dazu später mehr.
Noch vor dem Bauantrag könnte man um eine Besichtigung durch die Denkmalpflegebehörde bitten, da die MitarbeiterInnen häufig mit geschultem Blick Wesentliches zur Geschichte des Hauses ablesen können und somit auf die Änderung des funktionalen Zusammenhanges im Haus steuernd wirken können.
Voraussetzungen für eine Sanierung - Baubeschreibung, Bauaufnahme und Bauzustandsanalyse
Unerlässlich für jeden Eingriff in zu erhaltende Bausubstanz ist die genaue Dokumentation der Situation vor der Sanierung, die Bestandsaufnahme. Sie gehört laut Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) zu den besonderen Leistungen in Ergänzung zur Leistungs-phase 1, der Grundlagenermittlung. Die Arbeiten der Bestandsaufnahme sind besonders abzurechnen. Dieser Umstand, dass die Kosten nicht direkt bei der Grundlagenermittlung
(3 % der Architektenleistung) abzurechnen sind ist verständlich, da der benötigte Aufwand, je nach Sanierungsfall, sehr unterschiedlich sein kann. Andererseits sollte dem Bauherrn vom Architekten erläutert werden, dass hier ein unerwarteter Arbeitsaufwand entstehen kann.
Es gibt zwei aneinander gekoppelte Arbeitsbereiche. Die Baubeschreibung erfasst die Geschichte des Hauses in Wort und Bild und die Bauaufnahme stellt das Haus zeichnerisch nach dem Ist-Zustand dar. Mit dem Bauantrag wird die Baubehörde beides vom Hausherren abfordern. Im normalen Vorgang werden sie vom Architekten und Bauingenieuren bearbeitet, in speziellen Fällen auch von Büros für Bauforschung. Die anschließende Bauzustandsanalyse enthält Einschätzungen zu gesunden und schadhaften Partien. Sie ist vor allem wichtig zur Einschätzung des zu erwarteten Sanierungsaufwandes (Verhältnis „Sanierung / Neubau“), und sie hat große Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Umgestaltung eines Hauses.
Baubeschreibung
Für die Baubeschreibung werden zunächst alle Unterlagen, welche sich noch im Besitz des Eigentümers befinden, zusammen gestellt. Von großer Wichtigkeit sind dabei scheinbar zufällige Zeitzeugnisse, etwa Familienfotos um das Haus, Quittungen zum Einbau eines Ofens, Sanierungsdaten zum Haus usw. Bei Bürgerhäusern gehört normalerweise eine Kopie der Eingabepläne oder älterer Bauaufnahmen in die „Hausmappe“, aber leider stellt sich immer wieder heraus, dass bei Umgebindehäusern solche Zeichnungen fehlen. Das rührt wohl daher, dass Umgebindehäuser, ähnlich wie Scheunen und einfache Bauernhäuser, mehr oder weniger in Selbstbau entstanden sind. Im Dorf gab es meist einige Leute, zum Beispiel einen Schmied oder Tischler, die wussten wie man Umgebindehäuser baute, Unterlagen dazu brauchte man in einer solchen Arbeitsorganisation kaum.
Die Datensuche geht weiter im zuständigen Bauaktenarchiv, das für eine Gemeinde außerhalb, durchaus in Zittauer oder Löbauer Obhut sein kann. Dort gibt es – im Normalfall – zu jedem bebauten Gelände eine Akte mit der jeweiligen Brandkatasternummer. Der Akteninhalt zeigt Baumaßnahmen auf, wie die Ausführung des Sanitärbereichs, eines Zaunes oder eines Anbaus. Meist wurden diese aber erst ab dem späten 19. Jh. konsequent behördlich erfasst. Leider sind viele Archive durch Krieg, Feuer oder Hochwasser vernichtet worden. Des Weiteren sollte man sich bei der Gemeinde einen aktuellen Auszug des Grundbuchs beschaffen, woraus die Besitzverhältnisse zu ersehen sind. Zusätzliche Informationen sind möglicherweise bei Heimatschutzvereinen und Museen mit ihren Schätzen an Bildmaterial aller Art einzuholen. Als vorrangig wichtige Quelle sind alte Flurkarten zu sehen, welche den Standort des Umgebinde-hauses enthalten können und die über die damalige Erschließung Aufschluss geben. Nicht zuletzt gibt es mögliche mündliche Überlieferungen von interessierten Nachbarn. Die bestehenden zeichnerischen Bestandsaufnahmen und Entwurfspläne sind nicht nur für die Baubeschreibung relevant, weil sie die Hausdimensionen wiedergeben, sondern auch häufig mehrere Hinweise zum Besitzer, das Datum des Bauantrags und der Baugenehmigung, den Planersteller, die Baufirma und die ehemalige Hausfunktion enthalten. Neben Wohn- und Bauernhaus sind in der Region Weberhaus, Kretscham oder Schänke, wo auch das Dorfgericht tagte, Pfarrhaus, Dorfschule und Waisenhaus ausgewiesene Hausfunktionen. Für Fachleute sind unter Umständen von alten Bauzeichnungen weitere Hinweise am Zeichenstil und an der Papierart ablesbar. Stempel verraten Angaben zum Baumeister, etwa ob dieser sich Architekt nannte, woraus man entnehmen kann, dass er studiert hatte. Übrigens gab es nur höchst selten weibliche Architekten. Die Baubeschreibung soll von einer fotografischen Dokumentation begleitet werden, wobei man nicht sparen sollte, um möglichst vieles vom unsanierten Haus darzustellen. Einzelne Schäden am Haus, etwa Putzabplatzungen oder Löcher in den Decken sind für den Architekten und Bauingenieur von großer Bedeutung, weil sie Aufschluss über viele konstruktive Dinge und manchmal über verdeckte, denkmalrelevante Zustände geben können, wie beispielsweise bemalte Decken und Wände hinter Gipskarton. Es empfiehlt sich auch, eine Chronologie in die Baubeschreibung aufzunehmen, die alle Daten zum Haus festhält. Am Anfang ist es relevant, das Gründungsjahr der Gemeinde, in dieser Region oft im 13. Jh. zu nennen. Nach der Ordnung der geschichtlichen Fakten zum Haus lassen sich die Hausteile besser einzeln beurteilen und es kann für die Sanierung diskutiert werden, was wesentlich ist und erhalten werden sollte. An Hand dieser detaillierten Hausgeschichte gibt es für den Hausherren und den Architekten die Möglichkeit, in Abstimmung mit der Denkmalbehörde, den Stil des Hauses zu bestimmen: zum Beispiel, ob man mehr das bäuerliche Haus von 1800 oder die Nutzung als Pfarrhaus im späten 19. Jh. in der Zukunft beibehält.
Bauaufnahme (Lit. 1, 3, 18)
Die Bauaufnahme enthält meist Grundrisse, einen Dachplan, Schnitte und die vier Ansichten, sowie den eingenordeten Lageplan. Es ist ein Maßstab 1:100 üblich, aber für Umgebindehäuser sollte man, zur besseren Darstellung der Holzkonstruktion 1:50 nehmen. Unerlässlich ist es, vom Umgebindehaus weitere Aufmaße zu erstellen, welche in Maßstab 1:10 oder größer die Holzverbindungen im Detail zeigen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Fachleute qualitativ zwischen Bauaufnahmen die sehr einfach sind, wie eine kleine Planskizze mit Hauptmaßen, entstanden bei der ersten Besichtigung, bis hin zum verformungsgerechten Aufmaß, das detailliert Setzungen und Schadstellen eines Hauses darstellt, unterscheiden. Schadens-kartierungen werden üblicherweise auf Kopien der Bauaufnahmen oder auch direkt in der Zeichnung oder einem Foto festgehalten. Mittlerweile gibt es in Ergänzung zum Zollstock viele handliche elektronische Geräte wie Laser-Distanzmesser und Geräte für die Höhennivellierung. Es ist sinnvoll die Erstellung der Bauaufnahme durch das Architektenteam durchführen zu lassen, das die Sanierung plant, weil so das Wissen um das Haus, das die Vermesser bei ihrer recht mühsamen Arbeit erhalten, später genutzt wird. Allerdings kann es notwendig und gewünscht sein, Vermessungsbüros die Bauaufnahme erstellen zu lassen. Bei höherem Anspruch an die Genauigkeit oder zur Einmessung größerer Bauten und eines Geländes mit Höhendifferenzen können sie die richtigen geodätischen Methoden vorweisen. Die Erfahrung zeigt aber, dass um Fehlinterpretationen der Messdaten zu vermeiden das bauhistorische Wissen immer vorhanden sein sollte.
Bei manchen Architekturbüros ist die Bauaufnahme ein weniger beliebtes Arbeitsthema. Diese Aussage kann man nach den finanziellen Auswirkungen des Arbeitsaufwandes ermessen. Die Bauaufnahme ist ganz am Anfang einer Sanierungsmaßnahme durchzuführen und kann, zusammen mit der statischen und bauphysikalischen Überprüfung, zu dem Ergebnis führen, dass das Projekt scheitert. Welcher Bauherr lässt sich da vom Architekten schon gern die Rechnung für die Bauaufnahme, einige Jahre vor Fertigstellung des Bauobjekts zeigen (Kapitallast)? Wenn das Büro seinen Mitarbeitern auferlegt, die Bauaufnahme schnell, also oberflächlich, zu machen, sind folgenschwere Fehler in der weiteren Planung vorprogrammiert. Das beschriebene Problem ist real. Es wäre gut, wenn – wie an Hochschulen und Universitäten traditionell im praxisnahen Lehrangebot üblich– Architekturstudenten weiterhin Bauaufnahmen von wichtigen Objekten auf Halde machen, weil dadurch – ohne größere Kosten – der Sanierungsprozess wesentlich beschleunigt wird. Solche Bauaufnahmen sollten sinnvoll, sowohl in der „Hausmappe“ des Besitzers, als auch bei der Baubehörde oder Stadtentwicklungsgesellschaft aufbewahrt werden.
Man könnte die Bauaufnahme auch als die Kür der architektonischen Zeichnung bezeichnen, also sind im Vergleich zur Entwurfszeichnung noch differenziertere Aussagen möglich. Mittlerweile hat die Bauforschung mit Hilfe ausgefeilter Methoden die Bauaufnahme derart verfeinert, dass hier die meisten neuen Erkenntnisse zur Baugeschichte gewonnen werden.
Bauzustandsanalyse
Neben den genannten Unterlagen Baubeschreibung und Bauaufnahme ist zur Vorbereitung einer Sanierung anschließend eine Bauzustandsanalyse notwendig. Die Bauzustandsanalyse dokumentiert mit Hilfe von Fotos und genaueren Untersuchungen die Schäden. Sie wird in die Kopien der Bauaufnahme eingetragen. Zu diesem Problemfeld können eine Reihe spezifischer Untersuchungen des Hauses notwendig sein. Bei komplexeren Restaurierungen betreffen sie etwa Statik, Baugrund, Farbe, Technikgeschichte, Baustoffe, Akustik, Holzschädlinge, Haustechnik und Bauphysik.
Widerstände beim Denkmalschutz (Lit. 3, 4i, 4k, 4o, 4p, 4q)
Ohne Zweifel gibt es eine Reihe von Gründen, warum neben einer hervorragenden oder redlichen Pflege einer Vielzahl der Umgebindehäuser doch noch viele, auch in exponierter Lage, unsaniert bleiben und vom Abriss bedroht sind. Im Einzelnen kann man die problematischen Gründe dafür aufzeichnen, die abgewandelt auch für andere Häuser gelten, hier aber in direktem Bezug zu Umgebindehäusern genannt werden.
Es gibt dafür sowohl subjektive als auch objektive Gründe. Ein oft bei Bauherren feststellbarer subjektiver Vorbehalt gegenüber der Denkmalpflege ist das Wunschbild, zeitgemäß komfortabel zu wohnen, was in einem Umgebindehaus nicht möglich wäre.
An dieser Stelle sei auf die Möglichkeit einer Grundrissumwandlung verwiesen, wobei einige objektive Probleme lösbar erscheinen. Dennoch kann und sollte man den Begriff „unzeitgemäß“ kulturell hinterfragen. So bietet der Wohnmöbelmarkt aktuell viele attraktive Objekte mit Stilelementen des rustikalen Geschmacks oder des englischen land-life-style.
Neben wertkonservativen Beweggründen kann man hier das Ansinnen der Nachhaltigkeit (englisch: sustainability) feststellen, wobei der Substanzerhalt und das Sparen der noch verfügbaren Ressourcen an erster Stelle stehen.
Kann man, abhängig von den Erfordernissen, zu jedem Haus Gründe anführen, warum nach heutigem Bedarf etwas zu ändern wäre, so sollte man doch gerade dem Umgebindehaus nicht jede beliebige Zielsetzung zubilligen. Ein wichtiger Ansatz zur Überwindung des subjektiven Widerstandes gegen eine geeignete Denkmalpflege liegt also darin, dass die Bauherren und eventuelle Mieter einen gewissen Respekt für die Bedingungen eines Umgebindehauses mitbringen, oder dafür offen stehen es zu erlernen.
Als wichtige Widerstände bei der Denkmalpflege sind allerdings auch objektive, bauseitige Einschränkungen zu nennen. Tatsächlich ergeben sich in der Regel beim Umgebindehaus bestimmte Bedingungen, die eine zeitgemäße Umnutzung in der Ausgangssituation erschweren. Wege zu einem sinnvollen Umgang damit, mit betontem Gefühl für den Kompromiss, sollen im Weiteren aufgezeichnet werden.
Niedrige Raumhöhe im Erdgeschoß (Stube)
Durchgängig sind die Raumhöhen meist niedrig. Es ist durchaus keine Seltenheit, dass die Unterseite der Deckenbalken sich nur 2 m über den Bodenbelag befindet und dabei die Raum-höhe bis zur eigentlichen Decke auf 2,15 m kommt. Nur dank der für denkmalgeschützte Objekte geltenden Ausnahmeregelungen ist baurechtlich so eine Raumhöhe erlaubt. Es empfiehlt sich, zu untersuchen, ob zumindest der Wohnzimmerboden im Erdgeschoß niedriger gelegt werden kann, was in Prinzip oft möglich ist weil sich kein Keller unter der Stube befindet. Es ist hier zu bemerken, dass damit eine bauphysikalisch richtige Behandlung des Fußboden-aufbaus, möglichst mit Wärmedämmung, erforderlich ist, wobei Fachleute bei der Planung hinzugezogen werden sollten. Im Falle einer feuchten Umgebung, entlang eines Dorfbaches zum Beispiel, wo häufig Umgebindehäuser angesiedelt wurden, sollte man die Vertiefung des Erdgeschoßniveaus gut überlegen und gegen die Nachteile abwägen. Insbesondere bei fehlender Drainagemöglichkeit dürften technisch Grenzen gesetzt sein. Interessant ist die Möglichkeit, das Fachwerkobergeschoss mitsamt Dach höher zu setzen und dadurch die Raumhöhe im Erdgeschoß zu vergrößern. Die Denkmalpflegebehörde hat schon früh in einem ihrer Merkblätter (Lit. 1., Teil C, Nr.7, 1981) entsprechende Vorschläge erläutert. Das ist natürlich ein größeres Unterfangen, das man heutzutage mit mechanischen Hubelementen durchführt.
Niedrige Raumhöhe in Obergeschoß (Fachwerk)
Die Möglichkeit einer Vertiefung der Lage des Obergeschoßbodens ist meist nicht gegeben. Zwar ist über der Stube häufig etwas Platz, bedingt durch die in der Regel unabhängige Konstruktion von Stubendecke und Obergeschoß mit jeweils einer eigenen Balkenlage. Dieser extra Platz ist aber bausystembedingt und zur Ventilation mit der Außenluft vorgesehen. Änderungen an diesem Aufbau können zu schweren Fehlern im statischen Gefüge, etwa einer möglichen Loslösung des Fachwerks von der zugehörigen Deckenbalkenebene und in der Bauphysik führen. Bleibt also die Erhöhung im Dachraum. Auch hier kann gelten, dass die Balkenlage über dem Erdgeschoß wichtiger Bestandteil des Dachgefüges ist. Im Normalfall nimmt sie die Schubkräfte der Dachschräge auf. Änderungen sollten nur in enger Abstimmung mit dem Statiker geschehen und vorzugsweise nur punktuell ausgeführt werden. Es bieten sich theoretisch Lösungen durch die Erstellung eines im Dach erhöhten Deckenabschlusses an, mit Beibehalt der frei gesetzten Dachbalkenlage. Auch hier könnte die Denkmalpflegebehörde skeptisch sein, da die ursprüngliche, für Umgebindehäuser typische Struktur beeinträchtigt wird.
Der gewölbte Massivbereich als scheinbar unnützer Klotz im Wege
Gegenüber der einfachen Wandstruktur von Stube und Fachwerkobergeschoss mit klaren Möglichkeiten für Fenster, empfindet der Laie den Massivteil häufig als schlecht nutzbar. Durch fehlende Heizwärme und Lüftung sowie Keller- und Stallnutzung ist eine unangenehme Assoziation (Spinnen!) vorweg genommen. Die dicken Außenwände nehmen viel Platz weg und die bestehenden kleinen Fenster geben bei dieser Dicke nur wenig Licht. Bei sorgfältiger Planung mit genau aufeinander abgestimmten Arbeitsschritten lassen sich jedoch gute Grundrisse für diesen Bereich entwickeln. Vor der Sanierung sollten die Wände auf Schadsalze (Nitrate u. a.) und kapillar aufsteigende Feuchte untersucht werden. Eventuell sollten Fachlabore Feuchtmessungen durchführen sowie Putz- und Steinproben entnehmen. Erst wenn das Ausmaß der Schäden festgestellt wurde, lassen sich mit Fachfirmen für Wandtrockenlegung sinnvolle Sanierungskonzepte entwickeln. Da manche der Sanierungstechniken mehrstufig sind, empfiehlt es sich, diese Maßnahmen über die gesamte Bauzeit zu verteilen. Das Mauerwerk ist durchweg verputzt, so dass Änderungen wie die Versetzung von Nischen und Wandöffnungen oder Leitungsführungen – innerhalb der konstruktiven und raumproportionalen Gegebenheiten – unauffällig durchführbar sind. Besonders in ausgeprägt ländlichen Gegenden hat man Sichtmauerwerk außen belassen, was einen gewissen malerischen Effekt ergibt. Die Region ist aber in der Hinsicht nicht unbedingt als vorbildlich zu bezeichnen, im Vergleich zur Rheingegend etwa, wo der ebenmäßige rote und gelbe Sandstein Verwendung fand. Lediglich das spröde Granitmauerwerk ergibt, insbesondere in größeren Bauten, manchmal ein wahres Kunstwerk. Die Wölbung in kuppeliger Form (ovaloid) oder als Kreuzgratgewölbe, besteht meist aus Ziegel in halber Ziegeldicke. Der leere oder sandgefüllte Raum über dem Gewölbe kann für Leitungsführung verwendet werden. Wie in der Literatur anderswo schon bemerkt, lassen sich kleine Bäder gut in diesen Räumen integrieren. Auf ständige Belüftung, gegebenenfalls über Zwangslüftung (Ventilator), sollte geachtet werden. Die für Holzwände nur bedingt einsetzbaren Fliesen sind im Steinteil weniger problematisch. Auch Küchen lassen sich im Prinzip in Steinteilen integrieren, eventuell mit vergrößerten Öffnungen zum Nachbarraum. Dabei tut sich allerdings bei einer modernen offenen Küche mit freiem Übergang ins Wohnen ein Problem hervor: Gegenüber dem Wohnbereich in der relativ gut gedämmten Stube ist der Steinteil eine bauphysisch völlig unterschiedliche Zone, mit verstärktem Heizbedarf. Auch hier wird eine sorgfältige Planung, zum Beispiel die Integration einer Fußbodenheizung, eine Lösung bringen, die vermeidet, dass sich auf die Steinwände Kondensat der anfallenden Raumfeuchte niederschlägt.
Der Dachraum als Kaltdach – Die Bedingung der extensiven Nutzung
Der moderne Mensch empfindet ein Satteldach als Nutzraum und weniger als das, was es historisch war, nämlich eine technische Lösung für die Regenabweisung und die Aufnahme der Schneelast, für eine gewisse Wärmedämmung und schließlich als Feuerschutz (Lehmschicht als Dachbodenbelag). Eine Raumnutzung, eventuell zur Aufbewahrung über den Winter war zweitrangig, und füllte kaum den vorhandenen Raum aus. Das zeigt sich schon daran, dass typische Speicherbauten eine größere Konstruktionshöhe der Balken vorweisen. Das Kaltdach, worüber wir hier sprechen, hat eine auf ein Minimum eingeschränkte Dachdeckung. Statt einer Verschalung mit Wärmedämmung hat das altmodische Kaltdach über den Dachlatten lediglich noch die Dachdeckung, meist aus Biberschwanzdachziegeln. Auch wurde selten Schiefer ohne Verschalung montiert, was handwerklich gesehen aber als regelwidrig gilt. Zugluft ist dadurch reichlich vorhanden und auch so gewollt. Eigentlich funktioniert in diesem Klima das Kaltdach, das selbst für die Bürgerhäuser in den Städten allgemein angewendet wurde, mit extensiver Nutzung hervorragend und es hat als Variante auch in der Zukunft seine Existenzberechtigung. Klar ist, dass eine derartige Herangehensweise den Investitionsbedarf bei der Sanierung verringert und gleichzeitig einen späteren Ausbau offen lässt. Aus denkmalpflegerischer Sicht positiv, vermeidet man mit dem Beibehalten des Kaltdaches die Notwendigkeit, Änderungen am äußeren Anblick vorzunehmen. Außerdem ist der Reparaturbedarf am Dach leicht feststellbar und kann unmittelbar, ohne Abbrucharbeiten an irgendwelchen Schichten ausgeführt werden. Will man trotzdem weitere Wärmedämmung im Dachbereich anbringen, so könnte man diese in oder auf der Obergeschossdecke vornehmen. Hierbei kann eine unangenehme Folge sein, dass der Dachraum selbst, gegenüber der früheren Situation, als von unten her Heizwärme übertragen wurde, kälter wird, was im Winter zu Kondensatfeuchte führen kann. Bewusstes Lüften ist hier eine Lösung.
Der ausgebaute Dachraum mit Möglichkeiten einer intensiven Nutzung
Als nächste Möglichkeit des Umgangs mit dem alten Dachraum kommt die Ausführung als Warmdach oder als hinterlüftetes Kaltdach mit beheizbarem Ausbau als Schlaf-, Bad- und Gästezimmer in Frage. Dabei wird, um vollwertigen Wohnraum zu gewinnen, die Wärme-dämmung im Bereich der Dachschräge und Giebel durchgeführt. Der Laie sollte dabei unbedingt mit dem Planer die Möglichkeiten durchsprechen und die tatsächlich gewonnene Nutzfläche und Raumhöhe berechnen, da man sich schnell verschätzt. Der relativ hohe Kostenaufwand kann enttäuschen wenn man folgende Einschränkungen sieht. Als erstes gilt es, den neuen Fußbodenaufbau des Daches zu berücksichtigen. Zum Ausgleich von Verformungen, sind für eine horizontale Bodenfläche, sowie Spezialdecken für die Bäder bald 5-15 cm nötig, welche dem freien Dachraum jetzt fehlen. Jetzt folgt die Ertüchtigung der Dachfläche mit Dämmung. Da die Denkmalpflegebehörde die sog. Kubatur des Daches, also die Dimensionen der alten Form, nicht gerne geändert sieht, weil die aus dem Handwerk stammenden Proportionen dann verloren gehen, und Traufgesimsdetails entstellt werden, sollte in erster Linie der Ausbau nach innen gesucht werden. Zwischen den Sparren von rund 14 cm Dicke wird gerne die Dämmung (z.B. Steinwolle oder Styropor), sagen wir 16 cm dick, angebracht, wobei zwecks Hinterlüftung rund 4 cm Raum unterhalb der Dachlattenebene belassen werden soll. Durch Ausgleichshölzer unterseitig an den Sparren befestigt, wird der nötige Platz gewonnen. Bevor die Dachschrägenunterseite verschalt werden kann, sind die heute üblichen Unterspannbahnen und Sperren (PE-Folien) unter Beachtung der Bauphysik einzubauen. Insgesamt ragt damit der Dachschrägenaufbau 8 cm unterhalb der Sparren-unterseite hervor, oder, bezogen auf die Sparrenoberseite, 22 cm. Ähnliches geschieht mit der Kehlbalkenlage im Dachgeschoß, welche die richtige Stelle ist um den neu gewonnen Dachraum nach oben zu dämmen. Insgesamt werden die vorhandenen Raummaße allseitig verkleinert. Insbesondere bei eingeschossigen Umgebindehäusern mit geringer Breite, wo wirklich aus Platzgründen die Notwendigkeit vorliegt den Dachraum mit vollwertigen Räumen auszubauen, verbleiben geringe Nutzflächen. Der Tipp: Sehr genau und Raum sparend planen und bei der Treppe zum Dach eher eine steilere Variante wählen.
Traditionelle Fenstergrößen und die Tageslichtbeleuchtung im Innenraum (Lit. 3)
Wohl kaum ein Thema birgt so viel Unverständnis beim Laien wie die ursprüngliche Fenster-größe der Umgebindehäuser. Sie waren wirklich nur rund 30 cm breit bei 40 cm Höhe (17. Jh) mit Viererteilung durch Sprossenkreuz. Verglichen mit den T-Fenstern der Stadthäuser des 19. Jh., die minimal 1 m² groß sind, ist das nur rund 1/8 der Fläche. Stellen Sie sich über Ihrem Esstisch eine 25-Watt-Birne vor – statt die jetzt übliche drei mal 75 Watt – um einen vergleichbaren Beleuchtungseffekt zu erhalten. Nachdem bei einer Nutzung als Weberhaus der erhöhte Lichtbedarf nötig wurde, hat man rücksichtslos die Fensterglasgrößen nach oben erweitert. Auch die größeren Standartmaße von Fensterglas förderten diesen Prozess. Eine Folge davon war, das manchmal in Unkenntnis der konstruktiven Bedingungen des Fachwerks oder der Stube, Schaden am Gefüge entstand, etwa durch Zersägen von konstruktiv wichtigen Verbindungshölzern, was dann wiederum leider zum erhöhten Sanierungsbedarf beigetragen hat. In der Regel wird man, insbesondere bei den Stuben, die Fenster relativ klein halten, relativ mittig im Umgebindejoch, bzw. in Ausnahmefällen und in Abhängigkeit von der Nutzung andere Verglasungen suchen. Man kann feststellen, dass in Gegenden, die durch typische Fachwerk-häuser bekannt sind, die Öffnung der ehemals dichtgesetzten Felder im Fachwerk mit Glas zu erfolgreichen Neuerungen geführt hat. Leider – nach meiner Beobachtung – scheint sich das nur bedingt mit ähnlichem ästhetischen Erfolg auf Umgebindehäuser zu übertragen. Generell gesprochen könnte man verstärkt Glas einsetzen im Fachwerkteil (Obergeschoß), voraus-gesetzt, dass dort keine wertvolle Verschalung, z.B. mit Schieferverzierung, weichen muss. Zu einer effektvollen Erweiterung der Beleuchtung des Hauskerns führt die Möglichkeit, verstärkt Glas in Innentüren und Wänden einzusetzen. Ein praktisches Problem kann sich dadurch ergeben, dass verglaste Innenwände die Nutzung einschränken, meist sind Schränke an solcher Stelle unschön und widersprechen dem Sinn der Verglasung. Besonders Pflanzen und auch offene Regale wirken an verglasten Wänden dekorativ. Insgesamt lassen sich solche verglasten Innenwände eher in größeren Wohnungen oder Büros erfolgreich einsetzen. In solchen Innenwänden darf teils nur Sicherheitsglas angewendet werden: Unfälle durch zerbrochenes Fensterglas bei einem Aufprall könnten ernste Folgen haben. Weiter stellt sich hier die Frage, in welcher Art das Glas zu fassen sei. Sicher ist in einem „halben“ Holzhaus der Holzrahmen angebracht. Trotzdem könnte man auch technische Lösungen in Metall, mit dem Vorteil dünnerer Profile, einsetzen. Die elegant wirkenden, wenige cm dicken Stahlprofile sind in diesem Klima in Außenwänden kaum einsetzbar, da sie Kältebrücken darstellen. Gegen Anwendung im Inneren spricht dieses aber nicht. Bei Vollglastüren in Klarglas sollte man die Unfallgefahr bedenken und eine gewisse Erkennbarkeit der Glasebene im Halbdunkel durch geätzte Motive, Häkelarbeiten oder auch Klebefolien vorsehen. Die Beleuchtung über Öffnungen im Hausinnern hat übrigens in der Region eine lange Tradition, auch und besonders in größeren Häusern, wo häufig Fenster in Innentüren, in Wänden zum Nachbarzimmer und zum traditionsgemäß innen liegenden Treppenhaus auftauchen. Charakteristisch sind auch die kleinen Schlitze oder Gitter unterhalb von Treppenstufen, die eine Art Grundbeleuchtung für den Treppenraum in der Ebene darunter darstellen.
Die Gaupen als Lichtquelle und Raumgewinn (Lit. 3, 5)
Gaupen sind Schrägdachaufbauten, welche vertikale Fensterflächen aufweisen. Sie finden traditionell in Umgebindehäusern Anwendung. Als typisch gelten die kleine Fledermausgaupe und die waagerecht langgezogene Hechtgaupe, weniger die einfachen Schleppgaupen. Die beiden erstgenannten sind nur mit bestimmten Dachdeckungen (Schiefer und Biberschwanz), formschön und technisch einwandfrei erstellbar. Zwar wären theoretisch diese Gaupenformen auch in Metallblech ausführbar, was bei sanierten Stadthäusern durchaus eine Berechtigung finden könnte, aber für Umgebindehäuser ist das untypisch. Metallblech käme danach höchstens für Sonderfälle, etwa bei Übergangszonen in Frage. Die effektive Fensterfläche der traditionellen Gaupen ist für heutige Nutzungen meist relativ klein. Die Gaupe vergrößert merklich die Nutzfläche und verstärkt das Gefühl eines vollwertigen Wohngeschosses im Dach, da die wenig nutzbare Dachschräge dort bis zur Stehhöhe entfällt. Bei einer normalen Sattel-dachform wird traditionell und wegen ausgewogenen architektonischen Proportionen die Gaupe im mittleren Drittel gesetzt, mit deutlichem Abstand zu den Giebeln. Man geht ja davon aus, dass beide Giebel weitere Fensterflächen aufweisen, so dass die Zimmerchen dort genügend Licht erhalten. Ähnlich wie bei Wandöffnungen, können für die Gaupen die alten Stellen beibehalten werden. Im Prinzip und in der Vergangenheit immer wieder praktiziert, wie alte Anschlüsse im Gebälk zeigen, lassen sich die Gaupen allerdings nach Bedarf verschieben. Eindrucksvoll sind die Kompositionen aus mehreren Gaupen in Dachflächen bei größeren Bauobjekten.
Dachlichter und Sonnenenergiekollektoren in der Dachschräge
Der Autor stellt fest, dass jede Gesellschaft die Landschaft und ihre Bauten historisch prägt. Die Windmühle war in Westeuropa im 17. Jh. genau so präsent wie die Schornsteine im 19. Jh. und die Kühltürme im 20. Jh. Sie stellen monumentale Akzente in der Landschaft dar. Auf kleinerer Ebene veränderte sich das Aussehen der Straßenbeleuchtung. Warum sollen nicht auch Elemente zur Gewinnung von Sonnen- und Windenergie, typisch für das 20. Jh. ihren gut überlegten und sparsam dosierten Platz einnehmen? Denkmalpflegerisch leicht ketzerisch, könnte man feststellen, dass hier ästhetische Herausforderungen für Bauherren und Planer liegen. Erfreulicherweise schließt die technische Entwicklung auch Arten der Kollektoren mit ein, die von außen kaum oder nicht sichtbar sind, integriert im Dachsystem und unterhalb der Dachdeckung, bzw. in Wänden. Die Denkmalpflegebehörde hat sich, im Rahmen der erhöhten technischen Anforderungen in denkmalgeschützten Städten, geeinigt, dass an Stellen, wo man von der öffentlichen Straße keinen Einblick hat, sowohl Kollektoren als auch Fenster in der Dachschräge Anwendung finden können. Auf dem Lande ist dieses Kriterium durch die offene Siedlungsstruktur, die von allen Seiten Einblick gewährt, weniger sinnvoll und es werden Gesuche zunehmend positiv entschieden. Ein maßvoller Umgang mit diesen Elementen scheint das beste Ergebnis zu bringen. So sollte man in der Regel höchstens 30% einer Dachfläche mit Kollektoren besetzen und diese als Block gruppieren. Dadurch bleibt das traditionelle Dach als solches erkennbar. Das liegende Einbaufenster hat, wenn schon eingesetzt, eher in Scheunenbauten als im Umgebindehaus seinen Platz.
Raumgewinn
Wie anderswo berichtet, wurde die sprichwörtliche Erweiterbarkeit des Umgebindehauses, selbst mit ungewöhnlichen Mitteln, stetig praktiziert. Das zeigt die Nutzungsgeschichte vielfach auf. Die Raumzusammenstellung des Umgebindehauses ist klar unterteilt (Stube, Eingangs-bereich, Massivteil, Fachwerkobergeschoß, Dach) und diese Bereiche sind wiederum in Zonen unterteilt als (Umgebinde-)Joche und kleinere Unterteilungen als Sparrenjoche. Zahlreiche Umgebindehäuser zeigen dann auch Erweiterungsansätze auf, indem Joche in der Längs-richtung angefügt wurden. Da die Straßenseite für Erweiterung meist nicht geeignet war, entstanden nach hinten Anbauten in gleicher Länge als ein oder mehrere Teile der bestehenden Raumstruktur. Für das einfache Satteldach bedeutete das öfter eine Änderung, welche zu asymmetrischen Dachschrägen bzw. zu geknickten Dachflächen führte. Leicht spöttisch klingende Bezeichnungen wie Pferdekopf für das Schleppdach und Frackdach für ein Satteldach, dessen eine Seite nach unten gezogen wurde, deuten die ästhetische Problematik dieser Lösungen an. Die Denkmalpflege versucht schon lange nicht mehr, diese Besonder-heiten wegzusanieren in eine imaginären „ideale und schlichte Urform“, sondern begrüßt sie als Zeitzeugnisse einer bewegten Nutzungsgeschichte. Für den sanierungswilligen Bauherrn sind hier argumentative Ansätze gegeben, Erweiterungsbauten bei der Denkmalpflegebehörde mit Erfolg durchzusetzen.
Erhalt der Originalausstattung (Öfen)? (Lit. 4j)
Eine wesentliche Frage der Innenarchitektur ist, ob man beim Umgebindehaus Altes bewahren oder ein modern komfortables Ambiente schaffen will. Die Antwort wird beim Umgebindehaus allerdings teilweise vorweggenommen. Gibt es noch alte Vertäfelungen in der Blockstube, mit innenliegenden Schiebeläden (Ritschelläden), so werden diese als integrales Element des Umgebindehauses gesehen und man sollte es belassen oder verlorene Teile möglichst fachgerecht ergänzen. Früher wurde geheizt und partiell gekocht, am Ofen in der Stube. Viel Romantik lässt sich am und um den Ofen fest machen. Bei Bürgerhäusern der Stadt hat der Autor Bedenken, Öfen beizubehalten. Sie stehen oft genau dort, wo man eine Schrankwand aufstellen will. Und weil in fast jedem Raum ein Ofen stand, büßt man viel Platz ein, mit dem Wandabstand rund 1 m² Standfläche. Sicher gibt es schöne alte Öfen in Blau- oder Grüntönen mit Jugendstilmotiven oder solche aus Meißner Porzellan. Diese möchte man möglichst erhalten. Nach Einbau einer Zentralheizung verlieren diese Öfen ihre Hauptfunktion. Als gute Alternative kann man entweder einen der Öfen umrüsten und als Zusatzheizung einstellen, oder man kann einen modernen Kaminofen für Holzverbrennung mit verglaster Öffnung an die alten Stelle setzen, der hohe Leistung mit erhöhter Brandsicherheit verbindet. Im Umgebindehaus ist die Frage grundlegend anders zu stellen. Es hat sich gezeigt, dass der große Holzanteil im Umgebindehaus mit einer modernen Zentralheizung der Substanz Probleme bereitet. Niedrige Temperaturen, insbesondere in der Diele, im Dach und in den Schlafgemächern, kombiniert mit undichten Fenstern sicherten den Beibehalt ausreichender Holzfeuchte. Das langsame Auf-heizen der Stubenöfen wirkte sich günstig auf die Haussubstanz aus. Für das Umgebindehaus gehört sowohl aus Sicht der Denkmalpflege, als auch aus technischen Gründen ein Ofen als Zusatzheizung in die Stube. Noch ein nettes Detail. Man hat die Nischen des Umgebindes häufig benutzt zur Trocknung des Feuerholzes. Diese Schicht, die allerdings zum Schutz der Bohlenwand schon recht trocken sein sollte, bzw. auf ein wenig Abstand versetzt werden kann, wirkt als zusätzliche Wärmedämmung für das Haus.
Farbton und das Umgebindehaus (Lit. 1, 4h)
Was ist Farbe in der Architektur? Diese Frage im Bereich der Farblehre ist beim Sanierungs-entwurf von hoher Relevanz. Farbe ist die für das Auge sichtbare äußere Schicht des Materials. Wichtig ist, dass die Gesamtharmonie eines Erscheinungsbildes nicht nur von der Farbe im Sinne der Farbsubstanz herrührt, sondern anteilig durch die Materialbeschaffenheit roh belassener oder bearbeiteter Teile bewirkt wird. So werden durch Meißeln einer Steinsorte hellere oder dunklere Partien entstehen. Und die Oberflächenstruktur, die Größe der Körnung oder die Tiefe von verwitterten Holzfurchen bestimmen den Schattenanteil und bewirken damit einen verdunkelnden Effekt. Dann gibt es noch die Farbwirkung des Himmels und der tages- und jahreszeitabhängigen Sonnenfarblichkeit, die entscheidende Unterschiede beim gleichen Haus, scheinbar aus dem Nichts, zaubert. Nicht zuletzt beeinflusst auch die Pflanzenwelt in Hausnähe die Wirkung der Hauptfarbe an einem Haus. Nach dieser kleinen Einführung zur Farbe, die vor allem warnen will, auf absolute Urteile in dieser delikaten Frage zu setzen, können wir wenige denkmalrelevante Aspekte behandeln. Man sollte bedenken, dass die Farbe außen aus Gründen des Wetterschutzes anderen Ansprüchen genügen muss als innen.
Dunkelbraun bis fast schwarz für das konstruktive Holz
Ein traditionell häufig angewandter Farbton für die konstruktiven Teile Stützen und das Umgebinde ist dunkelbraun, was auf alte Holzschutzfarben zurückzuführen ist (z.B. Carboleum, Xylamon, Altöl). Häufig wird in den sichtbaren Balkenoberflächen des Fachwerks im Ober-geschoß die gleiche Farbe fortgeführt, mit traditionell weißem Anstrich der füllenden Felder. Anders als in typischen Fachwerkgegenden in Südwest- und Westdeutschland sind die Fachwerkfüllungen kaum noch mit den Balken begleitenden dünnen Farbstrichen gefasst. Die sonstigen verzierenden Elemente sind wohl derart vielfältig am Umgebindehaus, dass man auf diese architektonische Verzierung verzichtete. Die dunklen Farbstoffe, welche relativ diffusionsoffen waren, verringerten die Sichtbarkeit von Verwitterungsschäden. Bei der altertümlich rustikalen Farbgebung in Dunkelbraun kann man auch die Blockstube mit gleicher Farbe behandeln. Die Farbe der recht kleinen Fensterrahmen, in klarem Gegensatz zum Dunkelbraun, ist häufig weiß. Wesentlich für die Wirkung ist dabei die handwerklich korrekte Ausführung der nach außen schräg abfallenden hölzernen Fensterbank (eventuell hellgrau gestrichen) und der Fensterprofilierung oder des in einer bewegten Kontur gesägten Brettrahmens um das Fenster.
Die äußere Farbe der Bohlen und Blockbauteile
Im Prinzip kann man die Blockstube außen ähnlich malen wie das Umgebinde. Vorsicht ist hier geboten, weil unterschiedliche Bautraditionen, nicht nur geballt an einem Ort sondern auch gemischt vorkommen. Insbesondere in Tschechien (Böhmen) sind Stubenkonstruktionen üblich, bei denen Stämme oder Halbstämme rechteckig gesägt werden, mit Beibehalt der Stamm-rundung, ohne Rinde. Der Vorteil ist, dass man relativ wenig Sägeverluste hatte. Beim Zusammenbau entstehen einige cm dicke und nicht kerzengerade Fugen. Sie werden traditionell mit verschiedenen Substanzen wie gefetteter Wolle, Flachs oder Lehm gefüllt und dann in kontrastierendem Weiß gestrichen. Es fällt auf, dass in dieser Tradition auch Stuben im Obergeschoß vorkommen, möglicherweise daher rührend, dass in Bergdörfern die Form-änderungen durch langsam wachsendes Holz gering blieben. Es ist zu beachten, dass dieses rustikale Fugendetail bei vielen anderen Stuben einfach entfiel, zugunsten einer einheitlichen Farbe der gesamten Wandfläche. Die Denkmalpflegebehörde wird in der Regel das bauliche Ensemble charakterisieren und zur Weißmalung der Fugen dann raten, wenn die Umgebung des Hauses entsprechende Häuser aufweist, bzw. wenn einzelne Häuser als wichtige Sonderbeispiele gesehen werden, wie in Neusalza-Spremberg das Reiterhaus (Lit. 4s, 5).
Das bessere Holzhaus - Umgebindehaus interpretiert als Steinhaus
Architektur ist voller Symbolik, und das gilt auch für Volksarchitektur, wozu das Umgebindehaus gehört. Es gibt viele Hinweise an Holzhäusern, dass man versuchte, Stein zu imitieren. So gibt es Holzkirchen, die mit einem Metallblechüberzug in Steinverband versehen sind (Insel Chiloe, Chile, erbaut von Nachfahren aus dem Schwarzwald). Beim Umgebindehaus besteht schon der prominente Türstock aus Naturstein, sowie das Steinteil und der Steinsockel als Fundament der Bohlenstube. Auch die harte Dachbedeckung fügt sich in die Reihe. Alle sind Relativierungen der Interpretation, es handele sich um ein „reines“ Holzhaus. Sieht man genauer hin, so wird man bei manchen Häusern, vor allem im Bereich des Blockbaus, aber auch in der Verschalung des Fachwerkteils großformatige Steinverbände (rund 20 cm hoch) durch eingeritzte Fugen erkennen. Die Farben dieser Holzteile sind durchweg rot (Ziegelimitation) oder grau bis ocker (Natursteinimitation). Das Wort Imitation braucht hier nicht unbedingt negativ gesehen zu werden. Hier haben wir schon einen zweiten Hinweis auf eine historisch begründbare Farblichkeit.
Architektonische Verfeinerungen in der traditionellen Farbgebung (Lit. 3, 4g)
In jüngeren Zeiten, wo städtische Strukturen immer näher an die Lage vieler Umgebindehäuser gerieten, hat man auch andere Farben (grau, rötlich, grün) für die Holzkonstruktion gewählt, was bei genügender Wartung gestalterisch positiv wirkt. Man wollte wohl weg vom bäuerlichen Holzhauscharakter und hin zu architektonisch bedingten Stilen. Davon zeugen die klassizistisch anmutenden Verzierungen um die Fenster, in gleicher Farbe. Es handelt sich um kleine Säulen mit Kapitellandeutung, eine Zahnleiste oder einen Tympanon (Giebeldreieck). Welche Möglichkeiten der Differenzierung gibt es an den Holzteilen des Umgebindehauses? Die eine Gruppe betrifft die beschriebenen Konstruktionsteile und die Stube. Dann gibt es die Fenster und dazu die verzierenden Elemente (Spätbarock oder Klassizismus). Es folgt die Eingangstür im Türstock. Schließlich gibt es eventuell die über die handwerkliche Konstruktion hinaus gehende hölzerne Gesimsprofilierungen an der Dachtraufe. Es hat sich bewährt – wenn man nicht all zu mutig veranlagt ist – die Farbharmonie dadurch einzuhalten, dass man gleiche Farben wiederholt einsetzt, z.B. in allen Fenstern, Türen und Gesimsen. Eine zweite Strategie kann es sein, Ton in Ton mit Probeflächen (sog. „Farbachsen“) auszuprobieren, z.B. weiße Fenster neben hellgrauen Konstruktionsteilen. Mit Erfolg hat man auch für den Massivteil ähnliche Farben gewählt, wodurch die verschiedenen Teile des Hauses als zusammengehörend erscheinen und die Gesamtheit betont wird.
Vertäfelungen und Schieferwände
Als Wetterschutz fand man schon früh zu verschiedenartigsten Methoden der Verschalung vor dem Fachwerk vom Obergeschoss und Giebel. Fachwerkfüllungen aus Lehmstaken mit Lehmputzoberfläche können bei fehlender Wartung und Nichtbeachtung der handwerklichen Sorgfalt an den Fugen mit dem Fachwerk abreißen. Zugerscheinungen, das Eindringen von Feuchte und Wärmeverluste sind die Folge. Eine hinterlüftete Verschalung galt schon früh als hochwertige Alternative der Außenhaut. In der jetzigen Zeit bietet die Vertäfelung einen Anlass, den Wärmeschutz mit Dämmplatten außenseitig – dadurch technisch einwandfrei – unterzubringen. Aus architektonischer Sicht sollte eine möglichst dünne Dämmschicht und sorgfältigste Detaillierung als angebracht gesehen werden. Klar ist, dass dieser Hinweis einen gewissen Konfliktstoff gegen die Sichtweise des Bauphysikers liefert, aber redlich isolierende Dämmplatten von wenigen cm Dicke sind in Entwicklung. Die einfachsten Vertäfelungen wurden wieder in Dunkelbraun gehalten. Aus konstruktiven Gründen fand man schnell zu einer Zusammenstellung dieser Flächen als vertikaler Verbretterung, die von einer dünneren vortretenden Latte über den Fugen gehalten wurden. Konstruktiv braucht die Planke nur einseitig genagelt zu werden und Formänderungen durch Schwund oder Quellung können durch Verschieben unter der ebenfalls mit einer Nagelreihe gehaltenen Latte aufgenommen werden. Es hat sich dabei durchgesetzt, beide Holzteile in kontrastierender Farbe zu malen, z.B. grün und rot („Rinderblut“). Die unteren Enden vertikaler Verschalungselemente, mit Bögen und ausgerundeten Einkerbungen sind übrigens mehr als nur Verzierung. Sie stellen sicher, dass am unteren Ende der Latten Taufeuchte und Kondensat sich nicht länger aufhalten kann, was zur kapillaren Durchfeuchtung des Stirnholzes führen würde und so Schäden vorprogrammiert wären. Die Zahnform bewirkt, dass sich die Feuchte in Tropfgröße sammelt und abtropft. Die nächste Steigerung des Wetterschutzes war die Schieferwand. Das teure Material Schiefer, das eigentlich nicht zur Region gehört, ersetzte die Dachdeckung mit Holzschindeln oder Reet. Diese, auf alten Fotos noch sichtbare Dachdeckungen, galten als feuergefährlich und wurden später von der Baubehörde verboten. Die Möglichkeiten der Schieferdachdeckung, auch dekorativ geschwungene Formen wie Fledermausgaupen und Muster auszuführen, fanden eine Erweiterung in den Giebel- und Außenwandverschalungen. Wohl als Ballast auf rückkehrenden Schiffen, die die Handelsware Tuch aus der Oberlausitz in alle Welt transportierten, kam aus England hellgrauer und selbst rötlicher Schiefer neben dem dunkelgrauen Schiefer ins Land. Daraus entstanden dann die feinen Verzierungen mit Mustern und selbst Darstellungen wie Herzen und Jahreszahlen usw. Selbstredend ist diese Verzierung denkmalpflegerisch hoch eingestuft und sollte bei der Farbgebung des Hauses mit einbezogen werden. Da die Farbnuancen des Schiefers kaum noch auffindbar sind, oder nur teuer beschafft werden können, werden gelegentlich Platten in Ersatzmaterial eingesetzt. Nachdem der Einsatz von Asbestplatten verboten wurde, sind neue Materialien wie etwa aus Mineral- und Kunststoffgemisch entwickelt worden. Ihr langfristiges Verhalten ist aber noch ungeklärt. Auch hier gilt, dass bei Abriss eventuell die Schieferplatten sorgfältig und ohne Zerstörung der Nagellöcher für spätere Anwendung geborgen werden sollten.
Wissenschaftliche Farberkennung am Befund
Restauratoren können durch genaue Analyse der Bausubstanz eindeutige Aussagen zur Holzfarbe treffen. Die Denkmalpflegebehörde nimmt diese Art Hinweise, erbracht von qualifizierten Fachleuten mit der Unterstützung von chemischen Laboren, zum Anlass, ihre Vorschläge oder Auflagen zu formulieren. Tatsächlich gehört eine restauratorische Untersuchung des denkmalgeschützten Hauses zu ihren Auflagen, allerdings nicht nur, um Hinweise zum richtigen Farbton für die Sanierung oder Restaurierung zu bekommen, sondern auch zur Hausgeschichte. Historisch gesehen wechselte häufig der Farbton. Beeindruckend, wie geistesgeschichtliche, darunter auch Stilmoden, oder religiös bedingte Argumente eine Rolle spielen. So gibt es in Görlitz Steingewände aus der Renaissance, welche erst in Rot (Ziegel) und dann mit dem unbunten Grau gemalt wurden. Der farbenfrohe Barock wurde durch den eher in Tonnuancen gehaltenem Klassizismus abgelöst und in den Innenräumen einiger Kirchen der Region wurden die vormals mit Bibelparabeln bemalten Emporentafeln einfach weiß überstrichen, so dem neuen Pietismus Ausdruck verleihend. Ähnlich ist es bei Umgebindehäusern. Technisch gesehen soll bei Farbbefunden darauf geachtet werden, dass die Farbe ausgeblichen ist und dass daher kräftigere Farbtöne bei der Ausführung erlaubt sind. Restauratoren geben acht, dass die Befundstellen in Fugen oder hinter angeschraubten Schildchen gewählt werden, um möglichst „frische“ Farbsubstanz zu erhalten. Bei den Innenräumen können Farbbefunde an Wänden und Türen oder Vertäfelungen der Stube durchaus mehrere Schichten feststellen. Die Restauratoren kratzen mit einem Skalpell vorsichtig eine Farbschicht weg, bis die nächste Schicht hervortritt. Man sieht dann eine Farbskala von kleinen Rechtecken nebeneinander. Als letztes sollte der rohe Untergrund erscheinen. Insgesamt rückt man heutzutage etwas weg vom Bild, dass man eindeutig das Alte rekonstruiert. Technisch gesehen steht mit Farbsystemen wie RAL (Reichsausschuss für Lieferbedingungen, seit 1927) und NCS (Natural Color Systems) sowie Farbsystemen von Anbietern wie Brillux Scala und Sikkens eine viel größere Farbpalette zur Verfügung, als in alten Zeiten der Hausmaler zu bieten hatte. Der Architekt sucht daher im Gespräch mit dem Bauherren und der Denkmalpflegebehörde eine harmonische Farbgestaltung, dabei auch die Dachdeckung und die Bodenbeschaffenheit (Terrasse, Wegplatten, Geländer usw.) mit einbeziehend. Briefkasten und Außenleuchten und selbst die eigentlich verpönte Parabolantenne für den Fernsehempfang lassen sich in passender RAL-Farbe anbringen.
Farbrestaurierungen
Eine wichtige Differenzierung gibt es zwischen jenen Originaloberflächen, die mit Farb-pigmenten oder gar Darstellungen durchsetzt sind, und die nach konservatorischer Bearbeitung erhalten werden sollen, und solchen die neu gemalte rekonstruierte Motive enthalten. Bei den erhaltenswerten Originaloberflächen mit geblichenen Partien und eigener Patina sollte größte Zurückhaltung bei der Überarbeitung geübt werden. Die Aussage der Darstellung durch zu eindeutige neue Farbstriche wird entschieden geändert und das ist unerwünscht. Es handelt sich im Bereich Umgebindehäuser etwa um Balkendecken mit Farbfeldern zwischen den Balken, Türen, Vertäfelungen, Votivtafeln und mit Mustern bemalte Holzböden zur Imitation von hochwertigem Parkett oder Steinfliesen. Was ist Patina eigentlich? Patina ist die in Laufe der Zeit sich chemisch veränderte Materialbeschaffenheit in Kombination mit Schmutzschichten. Letztere wurden über die Umgebungsluft aufgetragen. Bei konservatorischer Behandlung sollte darauf geachtet werden, dass zwar der Schmutz, nicht aber die Farbreste entfernt werden. Auch hier gilt größte Zurückhaltung und eher sollte man Schmutzpartikel belassen, als durch mechanisches Reiben mit Putzlappen und Lösungsmitteln der Oberfläche zu schaden. Da manche derart behandelte Wandflächen brüchig sind, wird man sie bei gegebenem Anlass schützen, etwa mit einer auf kurze Distanz gehaltenen, seitlich zur Lüftung offenen Plexiglasscheibe.
Materialwahl und Farbe
Hohe Bedeutung ist der Auswahl der materialsichtigen Baustoffe, die die Wirkung des Hauses mit prägen, zu widmen. Es ist schon sehr fragwürdig, dass der Materialhandel seit 1990 wahllos modisch bedingte Bausysteme anbietet, statt die Übereinstimmung in einer einheitlichen Bautradition zu suchen. Es gibt zwei gegensätzliche Positionen die beide nicht recht befriedigen. Es handelt sich entweder um die Baustoffe mit „strahlend perfekter“ oder die mit „künstlich patinierter“ Oberfläche. Zum Dach kann man feststellen, dass direkt nach 1990 viele Bauherren anfingen, mit einem berechtigten Skepsis gegen die Baumaterialien der DDR-Zeit, dieses zu erneuern. In der fast euphorischen Stimmung des marktwirtschaftlichen Umbruchs setzten viele auf kräftige Farben und auf Oberflächen die eine Perfektion andeuteten. Dabei kamen Dachziegel und Betondachsteine mit glänzend glasierter Oberfläche zur Anwendung. Diese haben bei einem Umgebindehaus aber in der Regel keine Begründung. Die matten Töne der umgebenden Natur fügen sich nun mal besser zu einem leicht patinierten Dach, gedeckt mit (roten) Biberschwanzziegeln oder Schiefer. Auch die verfeinerte Engoben-Technik, bei der eine mattglänzende Farbe durch einen vor dem Brennen aufgebrachten Tonschlamm erzeugt wird, ist für das ländliche Umgebindehaus eher ungeeignet. Allerdings muss man feststellen, dass bei Umgebindehäusern mit typischen Stilmerkmalen (Barock, besonders Klassizismus) farbig engobierte Dachziegel stimmiger sein könnten als „einfach“ rote. Leider ist auch die künstliche Patinierung, der seit 2000 eine gewisse Perfektionierung widerfährt, nur bedingt für einen stimmigen Dachfarbton geeignet. Dabei erhalten die Ziegel durch unterschiedliche Brenntemperaturen oder durch andere Methoden verschiedene Musterungen und werden in bewusst wilder Mischung eingebaut. Je nach Qualität ist diese Art der Patinierung insbesondere dann statthaft, wenn es sich um Reparaturen von Teilflächen handelt. Zur Erläuterung dieses wichtigen Themas kann man auf die in Italien meisterhaft beherrschte Kunst, Dinge alt aussehen zu lassen verweisen. Neben direkten Betrugsversuchen steckt allerdings ebenso die wissenschaftlich fundierte Ansicht dahinter, eine ausdifferenzierte Restaurierung, häufig durch Rekonstruktion der alten Methoden und Materialien, zu erzielen. Aus denkmalpflegerischer Sicht ist die Sache einfach. Genau so, wie der Anblick eines Ensembles auch früher Akzentverschiebungen widerfuhr, wenn Dachziegeln neu gedeckt wurden, kann man auch jetzt ein dezentes einheitliches Rot für das Dach wählen und die Patinierung über die Zeit zur Wirkung kommen lassen. Ähnliche Überlegungen sollten bei der Bepflasterung gelten.
Farbexperimente
Zur Zeit gibt es einen Hang, das Holz am Haus mit Firnis oder mit der natürlichen Oberfläche hell zu belassen. Es wird dabei eine Holzpatina in natürlicher Vergrauung angestrebt. Man kann die Meinung vertreten, dass Natur belassenes Holz im Hausinnern gut passen kann. Es ist eben sinnvoll, hell einzurichten wegen den traditionell kleinen Fensteröffnungen. Für diese Region kann man beobachten, dass viele Beispiele mit natürlicher Oberfläche im Außenbereich unausgereift wirken: In der relativ feuchten Witterung werden die gewünschte Effekte verfehlt und es treten Anzeichen der – ungleichmäßigen – Verwitterung zu auffallend hervor. Auch in der plastischen Wirkung zwischen Umgebinde und der zurückliegenden Bohlenwand wirkt die einheitliche hellbraune Farblichkeit unsicher. Diese Meinung sollte aber nicht als Regel gesehen werden und – in gemäßigter Form – können Experimente und gestalterische Freiräume im Sinne der Weiterentwicklung einer historischen Tradition, ihren Platz behalten.
Farbe der Blockstube (innen)
Die Holzstuben sind traditionell kaum in „Verkehrsweiß“, also einem heute viel verwendetem Hellweiß, gestrichen. In der Regel wurden in jüngerer Zeit leicht lasierende (durchsichtige) Farbtöne wie Hellgrün oder Hellblau und andere gewählt. Selten kamen Rosenmalereien als Verzierungen dazu, mittig auf die Holzschiebeläden gemalt, in allerdings variierender Qualität. Die satt gealterte, natürliche Holzoberfläche aus der Entstehungszeit, eventuell zur Aufhellung gelaugt, ist eine gute Alternative. Als Farbakzent, in einer im Farbspektrum kontrastierende Farbe, dienten die Fliesen des Ofens oder der Bodenfläche.
Die Lage des Umgebindehauses in seiner Umgebung (Lit. 4a, 4b, 4c, 4e, 4k, 7d, 41)
Es gibt eine Reihe Faktoren, welche bei der Ansiedlung des Umgebindehauses in seiner Umgebung berücksichtigt wurden. Diese Faktoren sind ablesbar vom Bestand der Umgebinde-häuser und durch eine gewisse Wiederholung statistisch relevant.
Zur Entstehung der Siedlungen kann noch hingewiesen werden auf eine für die Oberlausitz gültige Dreiteilung. Außer der Stadt, gibt es das Hufendorf, man kann das definieren als Straßendorf mit seitlich in die Tiefe gehenden Grundstücken einzelner Bauern und das Bergdorf mit einem auf die jeweiligen beengten topografischen Begebenheiten bezogenen Wegeplan mit passender Grundstücksverteilung. Früher gab es in städtischen Strukturen auch Umgebinde-häuser, aber diese wurden weitgehend nach entsprechenden Feuerschutzverordnungen allmählich abgerissen, oder häufig ist dort die Stube durch massive Wände ersetzt worden.
Die Lage am Dorfbach (Lit. 1, 3, 4c, 4k, 5, 7d)
Die Bedeutung des natürlich fließenden Wassers für die Ansiedlung kann kaum überschätzt werden. In erster Linie ist Trinkwasser lebensnotwendig, aber das könnte man sich zur Not auch aus gewisser Entfernung besorgen, wie es meist der Fall war. Auch könnte man durch Grabung eines Brunnens Grundwasser entnehmen. Da aber Wasser sich früher nur bedingt in Mengen transportieren ließ, ist allgemein der erste Kern einer Ansiedlung in Wassernähe zu vermuten. Chroniken und andere Quellen bestätigen diesen Hinweis. Häufig sehen wir dann noch, dass der natürliche Bach drei künstlich angelegte Ergänzungen bekam: ein Wehr zum Stauen des Wassers, ein zweites Bachbett, das über einige hundert Meter unweit des Hauptstromes als Umleitung gegraben wurde, und eine Brücke oder alternativ früher eher eine Furt. Als Furt bezeichnet man eine Untiefe in einem Bach- oder Flusslauf, an der das Gewässer zu Fuß oder mit Fahrzeugen durchquert werden kann. In der Region gab es tatsächlich nur wenige Brücken. Neben dem Fehlen einer konstruktiv ausgefeilten Bautradition könnte dieses begründbar sein in stetiger Hochwassergefahr. Die gelegentlichen Hochwasser bedeuteten unweigerlich größte Beanspruchung für die Brücken und zusammen mit treibendem Gehölz verstopften die Brücken den freien Abfluss des Wassers. Eine Kompromisslösung waren leichte Holzbrücken, welche bei Hochwasser einfach aufgegeben und vom Wasser abgeführt wurden. In Friedersdorf und Großschönau gibt es interessante Beispiele älterer Steinbrücken. Der Grund einen zweiten Bach in Kombination mit einem Wehr anzulegen, war es, kontrollierte Mengen Wasser an technische Einrichtungen wie Wassermühlen zu leiten. In den Mühlen wurde nicht nur Getreide gemahlen, sondern auch Öl gepresst, sowie erhitztes Metall durch Hammerkraft verformt. Holzleim erhielt man durch das Zermahlen von Knochen. Auch wurden Stämme über Sägegatter zu Planken, Balken oder Halbstämme verarbeitet. Damit übernahm die Wasserkraft in dieser Region vieles, was nicht durch Handarbeit gelingen konnte. Für die Handwerksbetriebe war das Wasser weiterhin wichtig, weil etwa bei der Tuchbereitung und
-veredlung Wasser zum Waschen und Färben notwendig war. Die Wassernähe versprach ebenfalls genügend Grundwasser im Boden, damit das Gewächs auf dem Feld auch in trockenen Zeiten gedeihen konnte. Die Umgebindehäuser stehen überwiegend mit dem Dachfirst parallel zur Straße und mehr oder weniger mittig befindet sich der Eingang mit dem Türstock aus Sandstein. Auffallend kompakt sind in der Regel die Grundstücke am Wasser, eingeklemmt zwischen Bach und Dorfstraße. Die Nachbarhäuser stehen ausgesprochen dicht beieinander. Diese Enge dürfte bereits aus der Beliebtheit dieser Grundstücke wegen der eigenen Wasserentnahmestelle begründet sein. Sie entstand auch dadurch, dass die Straße zu Lasten der Grundstücksflächen verbreitert wurde. Passend zu so einem minimalen Grundstück ist eine pragmatische Außengestaltung mit den Hauptanliegen, neben den praktischen Dingen noch Garten und Obstbäumen einen Platz zu geben. Konsequent durchgeführte Symmetrie im Garten, wie sie etwa norddeutsche und holländische einfache Bauernhöfe vorweisen, ist eher die Ausnahme, schon dadurch bestimmt, dass die Topographie selten eben ist. Da die Dorfstraßen oft relativ kurvig sind, nämlich dem Bachverlauf folgend, sind diese Straßen als Bundesstraßen kaum nutzbar und dadurch glücklicherweise meist gering befahren. Eine besondere Sorgfalt erfordert der ruhende Verkehr. Dieses Problem kann gelöst werden durch gelegentliche Parkbuchten oder unter einen seitlich offenen car port. Gute Lösungen für Garagen sind rar.
Die einsame Lage
Traum vieler Bauherren ist es, ein Umgebindehaus bar aller Unannehmlichkeiten des modernen Lebens zu bewohnen, etwa abseits der Straße oder außerhalb des eigentlichen Dorfes. Die für Umgebindehäuser etwas untypische freie Lage ist für den Ausbau als Ferienwohnungen sehr geeignet. Wind und Wetter können hier durchaus Probleme bereiten. Im Winter sollte man bedenken, dass der Schnee stetig und planmäßig geräumt werden muss, damit das Haus zugänglich bleibt.
Die Lage an der Bundesstraße
Kaum problematischer kann man zeitbedingte Veränderungen dokumentiert sehen als in unbewohnten Umgebindehäusern direkt, nur in 1 m Abstand, an einer Hauptstraße und möglichst noch um 1 m tiefer als die Fahrbahnoberkante. „Wie können die Alten so unver-antwortlich gebaut haben?“ könnte man sich da fragen. Dieser Konflikt zwischen beiden Begebenheiten ist allerdings historisch erklärbar. In einer bäuerlichen Gesellschaft, etwa der des 17. Jh., gab es ein fein gesponnenes Netz von relativ schmalen Straßen zwischen den Dörfern und Ansiedlungen. Die Straßen, wovon viele noch existieren, sind traditionell mit Obstbäumen gesäumt, eine nette Geste gegenüber den Wanderern, was man von anderen Gegenden kaum kennt. Spätestens nach der Umwandlung von Hauswebereien in die Textil-industrie des 19. Jh., mit Gleisanschluss für Ferntransport der Ware per Bahn, mussten die Verbindungsstraßen verbreitert werden. Das kann man gut beobachten in Großschönau an der oberhalb des alten Dorfkerns gelegenen Hauptstraße. Die Verbreiterung einer Straße geht meist einher mit dem Wunsch schneller zu fahren, was bedeutet, dass die Straßentrasse grundlegend geändert werden musste. So wurden Krümmen begradigt oder sie bekamen zunehmend größere Radien. Auch Hügel oder Täler mussten ausgeglichen werden, indem sie abgegraben bzw. angefüllt wurden. Der Straßenaufbau wurde konstruktionsbedingt immer höher. Andererseits hat man, statt das alte Straßenpflaster aus Granit- oder Basaltquadern aufzunehmen, oft die Asphaltdecke darüber gelegt, was spätestens nach hartem Frost zu technischen Problemen führte. Der Grund schließlich, dass viele Häuser an Straßen tiefer liegen, ist auf das Phänomen zurückzuführen, dass das Straßenniveau sich tendenziell im Laufe der Zeit hebt. In Städten ist das vor allem dadurch bedingt, dass der Schutt nach Stadtteilbränden nicht abgeräumt wurde, sondern in der Umgebung des Einsturzes verteilt wurde. Man hat dabei den positiven Effekt mitgenommen, den Grundwasserstand relativ zum Straßenniveau niedriger zu legen. Dass in Deutschland der Begriff Bestandsschutz kaum für Straßen gilt, kann als eine Lücke im Denkmalschutz gelten. Anders gesagt: Die für Wegeplanung zuständigen Ämter wenden bundesweite Normbreiten an, ohne Rücksicht auf lokale Begebenheiten. Diese Allmachtstellung mag dazu verführen, auch weniger Rücksicht zu zeigen, wenn theoretisch Freiraum für Gespräch und Kompromiss gegeben wäre. Glücklicherweise lässt sich bei den Gemeindebehörden allgemein in den letzten Jahren ein Umdenken feststellen, noch dadurch bestärkt, dass die Dörfer gute Ausführungsbeispiele aufzeigten. Insgesamt sollte man, bei aller romantischen Schönheit eines stimmigen Dorfsbildes, nicht aus dem Auge verlieren, dass die neuere Wegeplanung die Verkehrssicherheit in hohem Ausmaß verbessert hat. Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass die betreffenden Häuser im Ensemble, das heißt in Zusammenhang der städtebaulich benachteiligten Nachbargrundstücke seit Jahrzehnten kaum Abnehmer finden. Kann man bei Erbschaften im Dorfe noch davon ausgehen, dass viele der Umgebindehäuser bei Verwandten oder Freunden einen für die Sanierung wirklich Interessierten finden, so sieht das bei den beschriebenen „Restposten“ am Rande der Bundesstraßen misslicher aus. Wenn solche Umgebindehäuser, die vormals durchaus stattlich waren, in anonymen Nachlass-verwaltungen landen, mit Interessenten, die keine Bindung zur Lebensart in der Region vorweisen, und die schon gar nicht den reichen Erfahrungsschatz des Wohnens durch die Jahreszeiten in einem Umgebindehaus besitzen, ist der Bestand bedroht. Das meiste hier Beschriebene begründet die großen Defizite für den Denkmalschutz der Umgebindehäuser, die direkt entlang der Hauptstraßen stehen. Einzelne Aspekte dieser Thematik sollen nun zur Diskussion gestellt werden.
Erschütterungen durch vorbeifahrenden Verkehr
Unangenehm ist die Auswirkung des Verkehrs auf das Leben im kleinen Umgebindehaus, insbesondere des Schwerlastverkehrs. Nur die Tatsache, dass es sich bei diesen Straßen nicht, wie allgemein bei Autobahnverkehr, um einen Dauerbelastung handelt, macht diese Art der Störung erträglicher. Eine technische Lösung dafür gibt es kaum. Dammwände oder Schlitze im Erdboden könnten theoretisch einen Teil der dynamischen Energie ableiten, aber wirklich wirksame Verfahren sind dem Verfasser unbekannt. Als geeignete Funktion dieser Häuser sollten vielleicht eher Büroflächen, mit Kleinwohnungen im Obergeschoß, statt Wohnungen für Familien vorgesehen werden. Eine sinnvolle Maßnahme wäre, das Problem verkehrsseitig anzupacken: Einschränkung des Lasterverkehrs durch effektive Umgehungsstraßen; streckenweise Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h oder Schrittgeschwindigkeit (deutlich unter 20 km/h); Verlegung der Straßentrasse um wenige Meter. Letzteres könnte sehr kostspielig werden, da unterirdisch meist Leitungen mit betroffen sind. Außerdem gilt bei Teilung von Grundstücken in Privateigentum die Auflage, die Teilgrundstücke mit Eintrag der Änderungen im Grundbuch von beglaubigten Vermessungsbüros neu vermessen zu lassen.
Lärmbelästigung
Für die Betroffenen ist im Bewusstsein die Wahrnehmung der Erschütterung kaum von der Lärmbelästigung zu trennen. Sinnvoll ist es, die Lärmbelästigung zu dämmen, weil das positive Auswirkung auf das Erleben des Straßenverkehrs hat. Leider hat die Umgebindehausbau-technik bei dieser Fragestellung zwei negative Charakteristiken: Sowohl der Stube aus Bohlen als auch dem Fachwerk im Obergeschoß, fehlt in ihrem Wandaufbau das Potenzial Lärm genügend zu dämmen. Dieses ist vor allem durch Masse, gegebenenfalls auch durch Auftrennung der Wand oder der Fensterflächen in Schichten zu erzielen. Gute Bedingungen bietet dagegen der Steinteil von sich aus, so dass man zumindest ruhigere Raumzonen erstellen kann. Die Dämmung von Holzfenstern mit Schallschutzfenster (doppelt oder dreifach) ist gut möglich, geht aber auf Kosten der Authentizität der ursprünglich handwerklich gearbeiteten Fenster. Auch Außentüren sind lärmdämmend – und zugleich sicherheitstechnisch – gegebenenfalls zu ertüchtigen. Im Prinzip sollte der Lärmschutz für den gesamten Aufenthaltsbereich gelten und keine Lücken haben. Schon eine kleine Öffnung macht alle Bemühungen zunichte.
Entlüftung
Mit den Fachplanern für Heizung und Lüftung sollte schon vor Baubeginn die Lage an einer verkehrsreichen Straße durchdiskutiert werden, da einfache Lüftungsmöglichkeiten durch geöffnete Fenster doppelt eingeschränkt sind. Einerseits ist die Luft der Straße von schlechter Qualität, da in Stoßzeiten und witterungsbedingt äußerst staubig und abgasbelastet. Andererseits entfällt bei geöffnetem Fenster jegliche Lärmdämmung. Die Lösung ist in einer möglichst gartenseitigen Lüftung, also der der Straße abgekehrten Seite zu suchen. Da für die Holzbauweise Lüftung und Ventilation notwendig sind, sollte man als Ergänzung eventuell im Bad oder in der Küche eine zusätzliche mechanische Lüftung über das Dach erstellen. Auch gibt es auf dem Markt immer ausgereiftere Methoden, die Fensterbelüftung über Lärmfilter zu ermöglichen.
Der fehlende Gehsteig
Eine sonderbare Sache ist es, dass Gehsteige im hier geschilderten Problemfall einfach fehlen oder nur 80 cm breit sind. Man könnte das als einen gesellschaftlichen Skandal anprangern, aber hier soll vorgeschlagen werden, das Beste daraus zu machen und auch dafür Verständnis zu haben, dass ein normierter Gehsteig nicht immer das Dorf schöner aussehen lässt. Wir haben schon erwähnt, dass der Eingang der meisten Umgebindehäuser zur Straße liegt, mittig in der Längsseite. Eine Eingangssituation ohne genügend Abstand vor der Eingangstür ist unfallgefährdend, bringt Straßenstaub und -geruch ins Haus und ist eine Lücke in der Lärmdämmung. Das Gesagte reicht wohl aus für eine Anregung, den Hausgrundriss auf alternative Erschließungsmöglichkeiten zu untersuchen. In der Praxis schon mit Erfolg erprobt ist die Möglichkeit, die alte Haustür als Eingang aufzugeben. Die neue Tür kann dann eventuell die, meist der Eingangstür im Flur gegenüberliegende, zweite Tür zum Garten hin sein. Damit wäre selbst die gleiche Grundrissstruktur beibehalten. Oder – wenn man den langen Weg sparen will bzw. Sicherheitsbedenken hat – kann man auch eine Eingangssituation an einer der Stirnseiten erstellen. Es empfiehlt sich, die Stellfläche für den PKW sorgfältig mit der neuen Eingangssituation zusammen zu planen. Auch weitere Hinweise wie eine kleine Sitzbank anzustellen, so dass auch Fremde die Änderung auf Anhieb erkennen. Im Hinblick auf den Erhalt der ursprünglichen Hausstruktur ist die erstgenannte Alternative, mit der Verlegung des Zugangs nach hinten, besser.
Die stillgelegte Eingangstür mit steinernem Türstock und seitlichen schmalen Fenstern
Haben wir damit im Prinzip eine Lösung gefunden, mit der man an der verkehrsreichen Straße wohnen kann, so ist dennoch die Denkmalverträglichkeit zu überprüfen. Warum sollte man nicht den ganzen Eingang mitsamt verziertem Türstock einfach versetzen? Zu Recht wird die Denkmalpflegebehörde hiergegen Einspruch erheben. Die klare Struktur des Umgebinde-hauses würde durch eine derartige Veränderung an Qualität verlieren. Besser ist es, die Tür an ihrer alten Stelle zu belassen als Zeugnis vergangener Zeiten und als eventuellen Notausgang. Die Erschaffung einer neuen, ebenfalls sorgfältig gestalteten, einfachen Eingangstür ist das kleinere Übel. Man sollte – technisch gesehen – dennoch versuchen, den Wärme- und Lärmschutz an der alten Eingangssituation zu verstärken. Der Denkmalpfleger sieht sich hier vor einer schwierigen Frage. Die alte Tür ist häufig sehr wertvoll mit ihrem Holzhandwerk, den handgeschmiedeten Bändern und eventuellen Schnitzwerkverzierungen, einem zentral platzierten Knauf und dem Kastenschloss an der Innenseite. Würde man zur Verbesserung der erwähnten Dämmwerte – sehr radikal – die Türöffnung ausmauern, so würde die Tür deutlich an Charakter verlieren, da innenseitig die Diele verändert werden müsste. Trotzdem könnte dieses eine Lösung sein, für den Fall, dass die Funktion der alten Diele sowieso geändert werden müsste. Unbedingt sollte darauf geachtet werden, dass die alte Tür hinterseitig genügend Ventilation behält, da sie sonst verfaulen würde. Als diskutierbare Lösungen könnten gelten, statt der Mauer eine zweite Tür an die Innenseite zu setzen, eventuell mit dem Kasten-schloss der alten Tür, bzw. eine Vollglastür. Eine bereits praktizierte Möglichkeit ist es, die Profilierung des alten Türblattes auf eine neue, dickere und (einbruch-)sichere Tür fest zu verkleben. Das alte Türblatt wird dazu in zwei Hälften längs zersägt, und die Sägefläche abgehobelt vor Vereinigung mit dem neuen Türblatt, im Sandwichaufbau.
Der zweite Gehweg
Für die beschriebene ungünstige Lage eines oder mehrerer Umgebindehäuser gibt es bei guten sonstigen Voraussetzungen die Möglichkeit, eine städtebaulich geprägte Entlastung zu suchen, indem man die gesamte Erschließung gartenseitig erstellt. Diese attraktive Möglichkeit setzt voraus, dass Nachbarn und Gemeinde eine entsprechende Änderung der Infrastruktur wollen und – in der Regel – dass die öffentliche Hand bei der Finanzierung unterstützt.
Die zur Straße vertiefte Eingangsebene
Für die schon beschriebene Situation, dass sich die Straßenebene deutlich oberhalb der Eingangsebene befindet, gilt es, eine verträgliche Gestaltung zu finden. Grundsätzlich kann man feststellen, dass kleinmaßstäbliche Anpassungen an das Gelände und gekrümmte
Wegeführungen zum Umgebindehaus passen. Pragmatisch sollte man in erster Linie auf die technischen Erfordernisse achten und die Gestaltung daran anpassen. Ist genügend Abstand vorhanden zwischen Haus und Straßenrand, so kann eine Böschung (weich) vor der seitlichen Einfassung der Straße (hart), etwa eine Stützmauer aus Natursteinmauerwerk oder aus Beton-elementen, angelegt werden. Der Vorteil eines weichen Überganges ist es, dass Regenwasser natürlich abfliesen oder wegsickern kann. Wie auch immer sollten die Geländesprünge in kurzer Entfernung zum Haus eher hart als weich gelöst werden. Da die Erde lange die Feuchtigkeit speichert, und die Sonne an verwinkelten Stellen kaum auftrifft, sowie der trocknende Wind nicht greift, sind dort im Sockelbereich immer Holzschäden am Haus zu erwarten. In Gegensatz zu früheren Zeiten, wo lediglich abfallende Pflasterung und offene Rinnen das Wasser ableiteten, kann man heutzutage durch Dränage und Kanäle, mit Zugang für die Wartung, den Abfluss sicher stellen. Die vertiefte Lage hat weitere Nachteile. Spritzwasser von vorbeifahrenden Fahrzeugen verursacht eine ständige Verschmutzung und Feuchtezufuhr, gegebenenfalls auch aggressive Taumittel an die Hausfassade. Mancherorts entgeht man dem, indem man das offene Geländer, das hier wegen dem Höhenunterschied manchmal erforderlich ist, mit durchsichtigen Feldern (Plexiglas oder Sicherheitsglas) zusetzt. Das ist ein ungewohnter Anblick, könnte aber wegen der benachteiligte Lage als Linderungsweg aufgefasst werden. Auch hier gilt, dass eine sorgfältige Gestaltung und Minimierung der Maßnahme Voraussetzung ist. Übrigens sind diese nur 1 m hohen Felder kaum als Lärmschutz wirksam, trotz der optischen Ähnlichkeit mit Lärmschutzmaßnahmen auf Brücken.
Die Sanierung ohne Nutzung?
Die Denkmalpflege hat nicht nur einen Platz im Bereich der schöngeistigen Kultur, die zwar Geld kostet aber sonst keinen materiellen Nutzen bringt. Dieser Denkmalbegriff führt zu Aktionen, bei dem ein Denkmal gerettet werden soll, auch ohne eine Nachnutzung anzustreben. Gegenüber diesem eingeengten Denkmalbegriff gibt es das Streben nach Nachhaltigkeit im Denkmalschutz (englisch: sustainability), wonach den Erhalt der Substanz eines der wichtigsten Ziele ist. So werden Ressourcen an Energie, Arbeit und Zeugnisse immaterieller Werte gespart und erhalten. Diese ganzheitliche Näherung des Phänomens Umgebindehaus steht kritisch zur Sanierung der Hülle eines Denkmals als Sichtobjekt, ohne inneres Leben. Praktisch gesehen ist es für ein Haus nicht gut, wenn es über längerer Zeit unbewohnt bleibt. Die Heizung, das Lüften und die gelegentlich Säuberung im Normalfall schützt das Haus vor Verfall und garantiert jahrzehntelange Reparaturfreiheit.
Eine besondere Art der Rettung eines gefährdeten Umgebindehauses: Die Umsetzung (Anastylose) (Lit. 4r, 14)
Ist ein denkmalgeschütztes Haus nicht mehr für eine Neunutzung zu retten, so wird in bestimmten Fällen eine Umsetzung an einen anderen Ort bevorzugt. In der Regel betrifft es Denkmäler, die von außen gefährdet sind, z.B. durch infrastrukturelle Änderungen (Stausee, Wegeplanung, Tagebau, Großflughafen). Politisch werden die infrastrukturellen Maßnahmen dann als übergeordnet eingestuft, wenn die Einspruchmöglichkeiten beim Amt oder vor Gericht ausgeschöpft sind. In Rietschen gibt es eine Ansammlung von Schrotholzhäusern aus Dörfern, die dem Tagebau zum Opfer fielen, mit dem ehemaligen Erlichthof als wichtigstes Ensemble. Darunter befinden sich auch Umgebindehäuser. Die Schrotholzhäuser, meist reine Block-bauten, ähnlich wie Fachwerkhäuser, eignen sich gut für Umsetzungen, da sie ursprünglich als Baukasten zusammengesetzt waren und die Balken Abbundzeichen enthalten. Abbundzeichen sind einfache Kerbzahlen im Holz, aus denen man auf die zueinander passenden Teilen und die Reihefolge der Binderebenen schließen kann. Vor der Umsetzung werden die Teile an Hand einer Planzeichnung durchnummeriert und die Ziffern durch angenagelte Metallplättchen gekennzeichnet. Ein großer Vorteil dieser Vorgehensweise ist es, dass verfaulte Stellen in der Konstruktion hervortreten und diese ausgewechselt werden können. Die Anastylose birgt ein großes Problem für den Historiker. Der Umgebungswechsel bewirkt, dass die ursprüngliche Bedeutung des Umgebindehauses in seiner Ansiedlung nicht mehr ablesbar ist. Es fehlt der Baum und die selbst gepflanzte Hecke die gegen Wind schützten, die Wegeführung in Hinblick auf die Kirche, die Sichtachsen, der sonnige Platz mit einer Sitzbank. Wie vieles beim aktiven Eingriff der Denkmalpflege, bedeutet die Anastylose den Gang nah entlang der Geschichts-fälschung. Sorgfältige Dokumentationen in Bild, Planunterlagen und Beschreibung dürften diese Gefahr etwas lindern.
Die letzte Instanz: Abriss nach Baufälligkeit
Als wirklich letzte Gegebenheit für ein denkmalgeschütztes Haus gilt der Abriss, der von der Denkmalpflegebehörde in Ausnahmefällen genehmigt wird. An welchem Kriterium lässt sich ermessen, ob ein Abriss fällig ist? Ein grundlegend wichtiger Aspekt ist die fortschreitende Baufälligkeit. Denkmalschutz kann derart definiert werden: „dass er das Gebäude über sein natürliches Leben hinaus erhält“. Diese Bemühung, die aus Achtung für die Geschichte und Liebe für die Schönheit herrührt, also relativ „gute“ Gründe, hat einen Beiklang der Verlogen-heit. Man denke dabei an eine amerikanische Schauspielerin von über 90, mit blonden Haaren und zwischen den Falten im Gesicht glatte gepuderte Partien. Vielleicht sollte man da manchmal lieber urteilen: „Genug ist Genug“. Wo stecken die entscheidenden Stellen an denen ein Haus baulich zu Grunde geht? Beim Umgebindehaus, mit seiner Materialvielfalt der verschiedenen Bereiche ist genaues Hinsehen wichtig. Gerade in den Fugen, wo etwa Stein auf tragendes Holz trifft, kann sich vermehrt Feuchte ansammeln und erste Fäulnis am Holz bewirken. Der Sockel und das Dach sind zwei weitere ständig gefährdete Zonen, wie die Kollegen beschreiben. Besonders das dichte Dach und eine Regenwasserableitung, die nicht nur das Wasser vom Dach wegführt sondern auch aus der Fundamentzone heraus, sind erste Dinge, die Baufälligkeit verhindern. Sind bei der Baufälligkeit statische Zusammenhänge aufgebrochen, so werden auch die Wände und Decken zunehmend Risse zeigen. An dieser Stelle kann darauf hingewiesen werden, dass technisch fehlerhafte Sanierungsansätze leider zu schwerster Baufälligkeit beitragen können. Diese etwas traurige Erkenntnis muss der Beobachter anhand vieler typischer Fehler feststellen, die von gut meinenden Häuslebesitzern als werterhaltende Reparatur angesehen wurden. So ist die Verwendung von undurchlässigen Schichten beim Holzbau, auch Bodenbelägen, immer problematisch, da die natürliche Rest-feuchte im Holz keinen Weg mehr findet und zu Fäulniserscheinungen führt. Zumindest ein-seitig sollte die Feuchtigkeit verdunsten können. Neuartige Kunststofffenster bieten zwar besseren Wärmeschutz als die alten, führen aber häufig zu ähnlichen Feuchteproblemen in den Anschlusszonen mit dem Holz, nicht zuletzt wenn sie mit Polyurethanschaum (PUR-Schaum) eingebaut werden. Ist – aus welchen Gründen auch immer – der Abriss geplant, so wird die Denkmalbehörde doch noch wichtige Auflagen erteilen, deren Befolgung unbedingt sinnvoll ist. Es handelt sich einmal um eine Bauaufnahme, die den Bestand vor Abriss, nebst Fotos, dokumentiert. Andererseits werden wichtige Bauteile zu bergen sein, das heißt bis zur weiteren Verwertung in einem Depot verwahrt bleiben. Auf diese Art bleiben historische Baustoffe erhalten zum Einbau an anderer Stelle, als Beispiel für Rekonstruktionen und als materielles Zeugnis einer Bautradition. Die Art der zu erhaltenden Bauteile kann variieren. Als wichtigstes kann der Türstock aus ortstypischem Sandstein oder Granit genannt werden. Dann gibt es allerhand Gitter aus Metall, sowie Türen mit Beschlägen und Türzargen, Fensterrahmen mit Verzierungen, Balken mit typischen Profilen und Mustern, gut erhaltene Bohlen und Balken, den aus Fliesen gesetzten Kachelofen usw. Tipp: alte, leicht beschädigte Schieferplatten, die man für die Sanierung nicht verwenden will, kann man in Anbauten einbauen. Ebenso Steinplatten im Garten. Mittlerweile ist für diese Dinge der Nachhaltigkeit ein reger Markt entstanden.
Das Umgebindehaus in der Literatur
Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe wichtiger Bücher, deren Anzahl in den letzten Jahren auch angewachsen ist, nachdem einzelne Untersucher wie Karl Bernert den Grundstock in den 1970ern legten. Im 19. Jh. wird das Umgebindehaus in systematischer Literatur zu Holzhäusern eher nebenbei erwähnt. In der Zwischenkriegszeit 1918-1940 gab es anfangs, teils noch in der Weimarer Republik, dann aber verstärkt unter nationalsozialistischer Herrschaft Ansätze zu einem verstärkten Interesse an Umgebindehäusern, im Sinne eines konservativ geprägten Denkmal- und Landschaftsschutzes. Diese Bücher enthalten, neben ideologisch geprägten Fehldeutungen, wichtige Dokumentationen in Schrift, Zeichnung und Foto zum damaligen Bestand. Als interessantes Einzelphänomen sei auf den Versuch, neuartige Umgebindehäuser zu entwickeln verwiesen (Lit. 6).
Literatur
(1.) Ander, R., Merkblätter für Denkmalpflege zur Anleitung der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege in den Bezirken Cottbus, Dresden, Karl-Marx-Stadt und Leipzig, Hrsg. v. Institut für Denkmalpflege, Arbeitsstelle Dresden (1981), Red. J. Helbig, Teil C, Nr. 1-12
(2.) Bedal, K., Das Umgebindehaus im nordöstlichen Bayern, in: Archiv für Geschichte von Oberfranken 48, 1968, S. 271-282
(3.) Bernert, K., Umgebindehäuser, Berlin (DDR), 1988
(4.) Cieslak, J. u.a. (Redaktion): Umgebinde - Eine einzigartige Bauweise im Dreiländereck Deutschland – Polen – Tschechien, Königstein in Taunus 2007
(4a.) Cieslak, J.: Die Oberlausitz und ihre Bewohner, in: Umgebinde 2007, S 3-5
(4b.) Mirtschin, H., Umgebindeland Oberlausitz – Anmerkungen zur Kulturgeschichte der Region, in: Umgebinde 2007, S. 6-11
(4c.) Poprawa, P., Umgebindehaus und Dorfleben im Spiegel der Volkskultur, in: Umgebinde 2007, S. 12-16
(4d.) Schurig, C., K. Bernert: Die Konstruktion des Umgebindehauses, in: Umgebinde 2007,
S. 17-37
(4e.) Orgas, S., Theorien zur Entstehungsgeschichte des Umgebindehauses, in: Umgebinde 2007, S. 38-40
(4f.) Noky, T., Umbinden oder Hineinstellen – Überlegungen zur Entwicklung und Verbreitung von Stubeund Umgebinde, in: Umgebinde 2007, S. 41-46
(4g.) Bernert, K., Zierendes am und im Umgebinde, in: Umgebinde 2007, S. 49-57
(4h.) Rentsch, H., Farbe, Schutz und Schmuck am Umgebindehaus, in: Umgebinde 2007, S. 58-76
(4i.) Richter, K., Leben im Umgebindehaus, in: Umgebinde 2007, S. 77-92
(4j.) Cieslak, J., Kachelofen im Umgebindehaus, in: Umgebinde 2007, S. 93-97
(4k.) Neumann, U., Gärten am Umgebindehaus, in: Umgebinde 2007, S 98-100
(4l.) Rosner, U., Das Umgebindehaus in der südlichen Oberlausitz, in: Umgebinde 2007, S. 102-111
(4m.) Trocka-Lesczcyńska, E., Umgebindehäuser in Niederschlesien, in: Umgebinde 2007, S. 148-156
(4n.) Rdzawska, E., Das Umgebindehaus östlich der Neiße, in: Umgebinde 2007, S. 157-160
(4o.) Goldberg-Holz, C., Waltersdorfer Sandstein-Türstöcke, in: Umgebinde 2007, S. 182-191
(4p.) Wolf, K., Sanierung eines Hauses in Großschönau, in: Umgebinde 2007, S. 207-211
(4q) Michel, Erdmann, Sanierung eines Hauses in Hainewalde, in: Umgebinde 2007, S. 212-217
(4r.) Rieß, Fried, Die Umsetzung eines Umgebindehauses, in: Umgebinde 2007, S. 218-221
(4s.) Herzog, M., Neunutzung: Das „Reiterhaus“ in Neusalza Spremberg: Baudenkmal und Museum, in: Umgebinde 2007, S. 228-231
(4t.) Vallentin, G., Umgebindehäuser – ein Kulturerbe mit regionalpolitischer Bedeutung, in: Umgebinde 2007, S 237-241
(5.) Delitz, F., Umgebinde im Überblick – Zur Frage der Geschichte, Verbreiterung und landschaftlichen Ausprägung einer Volksbauweise, Zittau (1987)
(6.) Franke, H., Ostgermanische Holzbaukultur und ihre Bedeutung für das deutsche Siedlungswerk, Breslau 1936
(7a.) Rosner, U., Der Faktorenhof in Eibau, in: Umgebindehäuser, Zittauer Geschichtsblätter 2003, Heft 2/3, S. 3-7, 19
(7b.) Tomlow, J., Entwicklung im Holzhausbau – Das Schrotholzhaus, das Umgebindehaus und die industriell gefertigten Holzhäuser der Firma Christoph und Unmack in Niesky, in: Umgebindehäuser, Zittauer Geschichtsblätter 2003, Heft 2/3, S. 8-16, 20
(7c.) Schurig, C., Das Umgebindehaus – Sanierungsschwerpunkte an einer historischen Baukonstruktion, 27-32, 22
(7d.) Haebler, F. v., Das Kantorenhaus in Großschönau – Ein Typisches Umgebindehaus aus dem 18. Jahrhundert, in: Umgebindehäuser, Zittauer Geschichtsblätter 2003, Heft 2/3, S. 33-34
(7e.) Oettel, G., Alte Umgebindehäuser in Oybin und Lückendorf, in: Umgebindehäuser, Zittauer Geschichtsblätter 2003, Heft 2/3, S. 35-37
(8.) Hauserová-Radová, M, Das mittelalterliche Stadtwohnhaus in Mittelböhmen, in: Zur Bauforschung über Spätmittelalter und frühe Zeit, In: Berichte zur Haus und Bauforschung, Band 1, Jonas Verlag, o.O,o.J, S. 257-262.
(9.) Gerner, M. (Hrsg.), Ein Blockbau in der Mitte Deutschlands – Sanierungsproblematik zum Nachempfinden am Beispiel der Schrotholzkirche Wespen, Deutsches Zentrum für Handwerk und Denkmalpflege, Propstei Johannesberg, Fulda 1997
(10.) Hilger, K., Holzhaus-Siedlung in Denkmalqualität, in: das bauzentrum, Fachzeitschrift für Architekten und Bauingenieure, 11/1999, S. 48-55
(11.) Lamers, R., D. Rosenzweig, R. Abel, Bewährung innen wärmegedämmter Fachwerkbauten – Problemstellung und daraus abgeleitete Konstruktionsempfehlungen, Bauforschung für die Praxis, Band 54, Stuttgart 2000
(12.) Loewe, L., Schlesische Holzbauten. Düsseldorf, 1969
(13.) Mirtschin, H., R. Hartmetz, Zeitmaschine Lausitz – Lausitzer Holzbaukunst, Dresden 2003
(14.) Prietzel, L. u.a., Der Ehrlichthof und seine Nachbarn - Rietschen und die Umsetzung der historischen Schrotholzhäuser, Rietschen, 1997
(15.) Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen / (Sächsisches Denkmalschutzgesetz – SächsDSchG)
(16.) Thiede, K., Das Erbe germanischer Baukunst im bäuerlichen Hausbau, Hamburg 1936
(17.) Tomlow, J., Konrad Wachsmann's use of log building traditions in Modern Architecture, in: Proceedings International Seminar Wood and Modern Movement, Helsinki University of Technology, 3.6.-4.6.1999, Preservation technology DOCOMOMO-Dossier 4, August 2000,
S. 46-53
(18.) Tomlow, J., Bauarchäologischer Befund bei der Dokumentation eines Umgebindehauses (Hinterer Dorfweg 1, Friedersdorf a.S., Sachsen), in: Wissenschaftliche Berichte Hochschule Zittau/Görlitz, Nr. 1808 (2000), Heft 65, S. 32-52
(19.) Tomlow, J., Leben im Erbe – Die Hochschule Zittau/Görlitz engagiert sich für die Erhaltung der regionalen Baukultur, in: Soda – Kulturjournal im Länderdreieck, Oktober 2001, S. 13
(20.) 1. Umgebindehaus-Kolloquium der Euroregion Neisse, Zittau, 19. und 20. Juni 2003, Hg. R. Hampel. Red. C. Schurig, Wissenschaftliche Berichte Hochschule Zittau/Görlitz (FH), Heft 78, 2003, Nr. 2001/2005
(21.) Zwerger, K., Das Holz und seine Verbindungen – Traditionelle Bautechniken in Europa und Japan, Basel 1997








1. Eibau. Großes Umgebindehaus mit Mansardedach. Die Gaupen im Mansardegeschoss verweisen auf den Barockstil und stellen einen Einfluss städtischer Lebensweise dar.
2. Röderbrücke in Großröhrsdorf. Seltenes Beispiel einer erhaltenen Bogenbrücke aus dem frühen 19. Jh.
3. Walterdsdorf. Türstock in Sandstein mit charakteristischen schmalen seitlichen Fenstern.
4. Großschönau. Innenansicht einer alten Eingangstür zu einem Umgebindehaus, das Armenhaus. Klar ist, dass hier sowohl handwerklich als auch stilistisch denkmalrelevante Werte enthalten sind.
5. Großröhrsdorf/OL. Ein für das 18. und 19. Jh typisches traditionelles Fenster. Mittig sitzt ein Schiebefenster zur Lüftung. Die einzelnen Glasflächen sind klein, dafür aber trotz der nur 2 mm Glasdicke überraschend stabil.
6. Ebersbach. Feines dekoratives Schnitzwerk an einem Blockstubenfenster auf der Grundlage eines profilierten Rahmens.
7. Schönbach. Die Fenster zeigen zwei Stile in einem Haus vereint: im Hintergrund eine bäuerliche Interpretation des Rokoko und im Vordergrund der strengere Klassizismus mit flachem Dreiecksgiebel.
8. Schönbach. Der relativ einfache Fensterrahmen zeigt betont dekorativ motivierte Formen, wobei eine einfache Planke eine geschwungene seitliche Kontur erhielt. Der starke Farbunterschied hebt das weiße Fenster hervor. Die Fensterbank ist ein schräg abfallendes Balkenstück, mittig ausgehöhlt, zum kontrollierten Abfluss des Regenwassers.






9. Ebersbach. Türstock in Granitmauerwerk. Die notwendigerweise derben Fugen der groben Steinbrocken sind mit kleineren Steinen zugesetzt. Damit hoffte man das Auswaschen des Mörtels zu vermeiden.
10. Ebersbach. Beispiel einer traditionellen Vergitterung eines Fensters. Dahinter befindet sich häufig ein gewölbter Raum, der als Speicher genutzt wurde.
11. Dittelsdorf. Weißer Fugenverstrich, ein Merkmal, das am häufigsten in der tschechischen Umgebindehauslandschaft (Nordböhmen) zu finden ist.
12. Ebersbach. Umgebindehaus unmittelbar an eine Bundesstraße und unter Straßenniveau gelegen. Das führt zu Anschlusssituationen, die hohe Anforderungen an das technisch sorgfältige Detail stellen.
13. Hainewalde. Die sehr enge Nähe zur Straße führte zur Verlegung des Eingangs an die Stirnseite, ergänzt von einem Zugang an der Rückseite. Die alte Eingangstür mittig unter den beiden Gaupen wurde beibehalten, ist aber innen mit einer Verschalung versehen.
14. Waditz. Traditionelles Beispiel für die kontrollierte Ableitung von Wasser in der Nähe der Fundamentzone eines Umgebindehauses. Heutzutage sind unterirdische Kanäle und Drainage noch effektiver. Gute Ausführung und jährliche Wartung dieser Systeme ist dabei erforderlich.